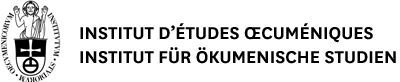Walter Nigg über sein Hagiographisches Werk
Fribourg 2010, S. 73-88.
Beim Studium der Kirchengeschichte bedrückten mich seit jeher die zahlreichen Ruchlosigkeiten und Unmenschlichkeiten, die im Namen des Christentums geschehen waren. Es war mir einfach unverständlich, dass in der Kirche schon früh und dann durch ihre ganze Geschichte hindurch so vieles geschah, was zum Evangelium in krassem Widerspruch stand. Wie konnten so viele Christen an den Unchristlichkeiten stillschweigend vorübergehen oder sie gar aus falscher Frömmigkeit verteidigen? Mich machten sie beinahe irre an der Kirche. Aus diesen Gründen wandte ich mich immer mehr von dem schwarzen Christentum ab und beschäftigte mich in steigendem Maße mit der hellen Seite der Christenheit. Das erste Buch, das ich unter diesem Aspekt schrieb, nannte ich Große Heilige (1946). Das Buch hat jedoch eine längere Vorgeschichte.
Während meines Göttinger Semesters (1923) hörte ich eine Vorlesung bei Erik Peterson über ein religionsgeschichtliches Thema. Er war ein höchst merkwürdiger, aber wenig beachteter Privatdozent, der später als Konvertit in Rom ein wenig glückliches Dasein fristete. In jenem Sommer waren wir nur zwei Zuhörer, die er einmal zu sich nach Hause einlud, um uns den ersten Entwurf seines Engelaufsatzes vorzulesen. Dieser Nachmittag war für mich bedeutsamer als alle Vorlesungen zusammen, die ich in Göttingen hörte. In Petersons Wohnung sah ich seine große Bibliothek, und ich fragte ihn, ob ich sie mir näher ansehen dürfe. Hier sah ich zum ersten Mal in meinem Dasein Tersteegens "Leben heiliger Seelen", die Werke der Theresia von Avila usw. Ich notierte mir alle diese Ausgaben in mein Notizbuch. Peterson beachtete mein Interesse nicht weiter. Zwischen uns kam es zu keiner Beziehung, aber er vermittelte mir Hinweise, von deren Bedeutung für mich er nie etwas erfuhr. An jenem Nachmittag stieß ich auf jene Gestalten, deren Namen in den Vorlesungen so nebenbei ganz kurz erwähnt werden und nach denen ich mich insgeheim immer gesehnt hatte. In den folgenden Jahren habe ich mir an mystischer und hagiographischer Literatur zugelegt, was ich nur ergattern konnte. Als Student belegte ich immer nur die Mindestzahl an Stunden und saß fast die ganze Zeit auf meiner Bude, wo ich mich mit innerer Freude in die Werke der Mystiker und Heiligen vertiefte.
Erst im Sommer 1939 wagte ich erstmals über Heiligengestalten eine Vorlesung zu halten, die wahrscheinlich mich selbst viel mehr erregte als meine Zuhörer. Dann begann ich nach reiflichem Nachdenken mit der Ausarbeitung der Vorlesung zu einem Buch. Die Schwierigkeit bestand darin, dass ich damals keinen Katholiken näher kannte, den ich über gewisse Dinge befragen konnte. Auch unsere Zentralbibliothek besaß wenig hagiographische Literatur. Ich schrieb mit der Sicherheit eines Nachtwandlers. Bei der Niederschrift befiel mich manchmal das unangenehme Gefühl, dass ich mich damit vollends zwischen Bänke und Stühle setzen würde. Die Protestanten würden sich nicht dafür interessieren, weil es doch ein katholisches Thema sei, und die Katholiken schon gar nicht, da der Verfasser ein evangelischer Christ sei, der davon ohnehin nichts verstehe. Doch kümmerte ich mich um diese unerquicklichen Einflüsterungen nicht weiter. Mich schlug das Thema dermaßen in Bann, dass es mir völlig gleichgültig war, was die Menschen dazu sagten. Für mich war es Neuland, und ich arbeitete mit Enthusiasmus daran. Die Heiligen waren doch - primitiv ausgedrückt - die religiös begabten Menschen, die dem Göttlichen zustrebten und keinerlei Machttendenzen verfolgten. Sie zu porträtieren forderte meine ganze Kraft heraus. Während sonst in der Kirchengeschichte nur von Männern die Rede ist, gab es unter den Heiligen auch zahlreiche Frauengestalten, die selbständig und ohne jede Nachahmung der Männer ihre weiblichen Geistesgaben großartig entfalteten. Welch Schattendasein führten im Vergleich zu ihnen die Frauen der Reformatoren, mit Ausnahme von Luthers Käthe. Die frauliche Verwirklichung der Heiligkeit ist eine bedeutsame Angelegenheit, weil ohne sie das Christentum an einer männlichen Einseitigkeit leidet. Ich gestehe, dass ich bei der Niederschrift nicht an die Ökumene dachte, die es damals noch gar nicht gab. Einmal kam mir während des Schreibens der Gedanke, mit diesem Buch den evangelischen Lesern die Tür zu einer neuen Dimension aufzustoßen, die ihrer Glaubenswelt eine Erweiterung vermittelte. Doch mit dieser schüchternen Erwartung hatte ich mich bereits arg vergaloppiert. An sich spielte die konfessionelle Frage für mich keine Rolle, ich hatte sie frühzeitig hinter mir gelassen. Ich war von den Heiligengestalten gefesselt, und das Geplänkel zwischen Katholiken und Protestanten fand ich reichlich antiquiert.
Die Aufnahme des Buches war merkwürdig und auch für den Verleger eine Überraschung.
Die Protestanten schüttelten mehr oder weniger über das Buch den Kopf, und jahrelang bekam ich von dieser Seite pure Verständnislosigkeit zu hören. Hatte ich mich mit dem Overbeckbuch vor fünfzehn Jahren aus der Theologie herausgeschrieben, so mit den "Großen Heiligen" aus dem Gesichtskreis der protestantischen Kirchenmänner. Seither existierte ich für sie nicht mehr, und auch ihre Universitätsprofessoren lasen mich nicht mehr. Sie wähnten mich auf dem Weg nach Rom, und etliche Pfarrer warteten, wie man mir sagte, mit der Stoppuhr in der Hand auf meine Konversion. Dass sie so lange vergeblich warteten und schließlich darüber wie die törichten Jungfrauen einschliefen, war ihre Sache. Persönlich dachte ich keine Minute in meinem Leben an einen solchen Schritt. Eine Konversion kam mir immer wie eine Ehescheidung vor, und beides hätte ich als Treulosigkeit seelisch nie zu überstehen vermocht. Dass es mir einzig und allein um christliche Gestalten zu tun war, dies kam meinen Glaubensgenossen gar nicht in den Sinn. Mein Zeugnis für die Heiligen schien mir seinen besonderen Wert darin zu haben, dass ich es als evangelischer Christ ablegte und mich nicht unter die Rompilger gesellt hatte. Das Konzilianteste, was ich von protestantischer Seite zu hören bekam, sprach viel später der Zürcher Kirchenratspräsident in einer Diskussion aus: "Walter Nigg ist für uns ein Sonderfall und als solchen müssen wir ihn gelten lassen." Meine Antwort war: "Ich danke für die Narrenfreiheit, aber sie genügt mir nicht!"
Die erste katholische Besprechung von "Große Heilige" drohte mir mit dem Index! Andere Rezensenten vermissten wiederum den sensus catholicus darin. Als die holländische Übersetzung erschien, erließen die Bischöfe des Landes prompt ein Leseverbot. Erst Ida Friederike Görres brach mit ihrer Besprechung in den "Frankfurter Heften" dem Buch die Bahn, so dass seither die Katholiken zu den eifrigsten Lesern wurden.
Den größten Genuss aus dem Buch schöpfte ich selbst. Ich bin damit zur Hagiographie vorgestoßen, die ich fortan zum Thema meines Lebens machte. Sie fesselte mich dermaßen stark, dass ich nie mehr von ihr loskam und auch gar nicht begehrte, sie hinter mich zu bringen. Die Hagiographie ist eine alte Literaturgattung. Gewisse Teile des Alten und des Neuen Testamentes gehören dazu. In der alten Kirche schrieb Athanasius die Vita Antonii, und Sulpicius Severus das Leben des heiligen Martin. Die Sammler der Aussprüche der Wüstenväter waren Hagiographen. Im Mittelalter wurden hervorragende Lebensbeschreibungen von Heiligen verfasst, die Legenda aurea mutet doch wie ein gotischer Dom an.
Keinesfalls fühlte ich mich als erster evangelischer Christ, der sich der Hagiographie widmete. Ich hatte darin beachtenswerte Vorgänger. Vor allem möchte ich Gerhart Tersteegen nennen, eine Gestalt, die selber den Namen "Heiliger" verdiente und die nur in ihrer einmaligen Bedeutung erfasst wird, wenn man sie unter den hagiologischen Gesichtspunkt stellt. Tersteegen schrieb das umfangreiche Werk "Auserlesene Lebensbeschreibungen heiliger Seelen". Es enthält lauter Lebensschilderungen katholischer Heiliger, was die evangelischen Leser erschreckte, obschon Tersteegen jede katholisierende Tendenz völlig fern lag. Gewiss haften seinem einzigartigen Werk Fehler an. Jedes Leben hat eine äußere und eine innere Geschichte. In der Regel interessieren sich die Leser für den äußeren Ablauf, während Tersteegen ihn kaum erwähnte und alles Gewicht auf das Innenleben legte. Er übernahm viele Formulierungen aus den alten Viten, wodurch seine Darstellung in sprachlicher Beziehung schwer lesbar ist. Tersteegens Werk wurde von den evangelischen Christen jedoch kaum richtig verstanden, obschon es wie ein erratischer Block dasteht.
Zu dem Zeitpunkt, da ich mich der Hagiographie zuwandte, lag sie im katholischen Raum arg darnieder, und von den Protestanten wurde ihre Bedeutung überhaupt nicht wahrgenommen. Die Heiligenbücher des 19. Jahrhunderts kamen mir in ihrer Süßlichkeit wie ranzige Butter vor. Es war für mich oft eine Bußübung sie zu lesen. Sie litten an einer widerlichen Schönfärberei und haben den Heiligen mehr geschadet als genützt, so dass sogar viele Katholiken geradezu eine Abneigung gegen diese lichtvollen Gestalten bekamen. Die Hagiographie musste unbedingt auf eine neue Grundlage gestellt werden. Doch spürte ich hinter den salbungsvollen Seiten verschüttete Quellen rauschen, die auf Freilegung warteten. Ja, hinter dieser allzu erbaulichen Literatur war lauteres Gold verborgen und zwar Gold, wie es die Christenheit nicht viel aufzuweisen hatte.
Das erste Erfordernis einer neuen Hagiographie erschien mir unbedingte Wahrhaftigkeit zu sein, die auch die Flecken der Heiligen nicht verschwieg. Sie selbst haben dies nie getan, sondern ihre Sünden ehrlich zugegeben. Augustin bekannte sich zu seinem außerehelichen Sohn, und Theresia von Avila schalt sich selbst ein böses Weib. Solche Geständnisse dürfen weder stillschweigend übergangen noch abgeschwächt werden. Zwar hat die Vertuschung schon früh in der Hagiographie eingesetzt. Die Samuelbücher beschreiben ehrlich, wie David den Uria beseitigte und mit dessen Gattin Bathseba Ehebruch beging, während die Bücher der Chronik das schwere Vergehen wortlos übergehen. Wie viel wahrheitsliebender verhalten sich die Evangelien. Sie scheuen sich nicht, die Verleugnung Christi durch Petrus sehr genau wiederzugeben, und dennoch bleibt er der führende Jünger. Alle Heiligen haben eine Passion durchgemacht, und die muss geschildert werden. Ihr Sein in der Glorie entzieht sich unserer Beschreibung. Wir müssen der Hagiographie unbedingt die Glaubwürdigkeit zurückgeben, gemäß dem Apostelwort: "Wir können nichts gegen die Wahrheit, sondern nur für die Wahrheit tun" (2 Kor 13,8). Nur dann beginnt sie aufs Neue zu leuchten.
Zweitens hat ein Realismus an die Stelle einer falschen Erbaulichkeit zu treten. Ich sage ‚Realismus‘ und meine damit nicht einen abgeschmackten Naturalismus, der gerne in grausigen Szenen wühlt - eine Gefahr, die gerade bei Märtyrerszenen nahe liegt. Es geht um die Wirklichkeit des Heiligen und nicht um fade Heiligenbildchen mit zum Himmel blickenden Augen und einem goldenen Reiflein um das Haupt. Daher ist ihr vorheiliges Leben ebenso ernst zu nehmen wie ihre Umkehr, die kein bloß psychologisches Problem ist. Tiefen und Höhen sind mit gleicher Kraft darzustellen, damit der Leser spürt: Das ist stark gesagt. In dieser Beziehung habe ich aus Bernanos' "Tagebuch eines Landpfarrers" sehr viel gelernt.
Drittens ist den übernatürlichen Geschehnfissen im Leben eines Heiligen durchaus eine zentrale Stelle einzuräumen. Sie dürfen nicht aus Furcht vor dem Rationalismus abgeschwächt werden. Das wäre geistige Feigheit. Die Heiligen sind letztlich nur von oben und niemals von unten zu verstehen. Die Verbindung von Realismus und Metaphysik hat Grünewald in seinem Isenheimer Altar mit elementarer Kraft dargestellt, und er bleibt hierin vorbildlich. Mögen darüber die Weltmenschen in ein Gelächter ausbrechen, das geht mich gar nichts an. Ich habe mich der Gnadenerlebnisse der Heiligen nicht zu schämen. Die Frage ist vielmehr, ob man die Kraft hat, sie in ihrer ganzen Tiefe darzustellen.
Daneben gibt es noch eine Reihe von hagiographischen Fragen, die neu zu überdenken sind: Wie sind altkirchliche Viten zu lesen? Doch nicht mit den Augen des modernen Historikers, dem jede Metaphysik abhanden gekommen ist. Darf man über die Berichte von Wundern der Heiligen stolpern? Muss man nicht eingedenk bleiben, dass es mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, als unsere Schulweisheit sich träumen lässt? Bedarf es nicht eines divinatorischen Spürsinnes? Muss man in der Hagiographie nicht den Mut aufbringen, dem heutigen Zeitbewusstsein entgegen zu treten? In ihr geht es doch letztlich um eine eminent existenzielle Angelegenheit, die auf die Voraussetzung aufbaut: Ohne Glauben erkennt man nichts. Schließlich haben auch evangelische Christen das Problem aufgenommen, ich erinnere nur an die Arbeiten von Jörg Erb und auch von Otto von Taube: "Brüder der oberen Schar" und seinen Aufruf "Die Heiterkeit der Heiligen".
Meine nächste hagiographische Arbeit war Vom Geheimnis der Mönche (1953), da die Ordensgründer doch als Heilige verehrt werden. Angeregt zu diesem Buch hat mich - was niemand vermuten würde - Franz Overbeck. In seiner Streitschrift "Über die Christlichkeit der Theologie" beurteilt er das Mönchtum als "eine Erscheinung, zu deren Würdigung freilich die katholische Theologie die Reinheit des Verständnisses längst verloren, die protestantische die Gerechtigkeit nie besessen hat" (S. 82). Dieser Satz stach mich in die Nase. Er reizte mich dahin, ob ich mit meiner überkonfessionellen Einstellung eine andere Sicht zustande brächte. Als ich 1931 meine Vorlesungstätigkeit an der Universität Zürich begann, kündete ich „Geschichte des Mönchtums" an. Zwar kam ich nicht über die Anfänge hinaus, aber aus dieser Beschäftigung ging zwanzig Jahre später mein Buch hervor. Zu dieser Arbeit ermunterte mich ein Prior: "Sie müssen das tun, wir Ordensangehörige sind immer etwas 'eifersüchtig' aufeinander und bringen hierin nicht die nötige Objektivität auf." Ich besuchte, als ich den Text geschrieben hatte, zu meiner Kontrolle verschiedene Klöster. Überall wurde ich zuvorkommend empfangen. Das Kloster, eine Schöpfung der alten Kirche, wurde vom Protestantismus fatal verkannt, während ich allezeit von der klösterlichen Kultur aufs Tiefste beeindruckt war. Allerdings mutete mich, nach dem sichtlichen Niedergang vieler Klöster in den 60er Jahren, mein Buch wie ein Schwanengesang an. Doch bin ich der Überzeugung, dass die Klöster auch diesen Tiefpunkt überwinden werden, denn in ihrer Geschichte wechselten vielfach Aufstieg und Verfall miteinander ab. Im übrigen hat mir mehr als ein Mensch gesagt, dass er durch dieses Buch veranlasst wurde, in einen Orden einzutreten, was ich freilich gar nicht beabsichtigt hatte.
Auch Des Pilgers Wiederkehr (1954) zähle ich zu meinen hagiographischen Schriften, mit der ich die christliche Gestalt aktualisieren wollte, die mir in der Neuzeit in Vergessenheit zu geraten schien. Ich verstand das Wort "Pilger" jedoch im ursprünglichen Sinn; eine Pilgerreise im Autocar mit Radiomusik scheint mir dieses Namens nicht würdig zu sein. Der Pilger unterscheidet sich grundsätzlich vom Wanderer. Er ist zielgerichtet auf eine heilige Stätte. Einmal wartete nach einem Vortrag ein arg zerlumpter, langhaariger Jüngling vor der Tür auf mich und sprach mich mit den Worten an: "Wie kommen Sie eigentlich dazu, über Benedikt Labre zu schreiben, der gehört doch auf unsere und nicht auf Ihre Seite?" Ich schaute mir seine vernachlässigte Kleidung an und erwiderte ihm: "Es freut mich, dass Sie das Benedikt-Labre-Kapitel gelesen haben. Wenn Sie auf das Äußere schauen, mögen Sie Recht haben, aber wenn Sie auf Labres Inneres achten, dann hatte der heilige Bettler etwas in sich, das wahrscheinlich bei Ihnen und der heutigen Protestjugend fehlt. Bedenken Sie dies nochmals." Dann reichte ich ihm die Hand und verabschiedete mich von ihm. Der Untertitel des Büchleins lautet: "Drei Variationen über ein Thema", und damit deutete ich an: Mich gehen alle drei Konfessionen an, ich kenne keine Ausschließlichkeit.
Die nächste hagiographische Arbeit war Der christliche Narr (1956). Mit ihr konnte die weltklug gewordene Christenheit schon gar nichts anfangen. Bereits der Titel erweckte nur Verständnislosigkeit. Offenbar wussten die meisten Christen nichts mehr von der Aufforderung des Paulus "Welcher sich unter euch dünkt weise zu sein, der werde ein Narr in dieser Welt" (1 Kor 3,18). Der Narr in Christo war so vergessen, dass ein Pädagoge an unserer Universität entrüstet zu mir sagte: „Das hat uns gerade noch gefehlt, dass einer kommt und Pestalozzi als Narr darstellt." Gerhard Hauptmann schrieb den Roman "Der Narr in Christo, Emanuel Quint", aber das war ein rein pathologischer Fall, der mit der christlichen Narrheit so wenig zu tun hatte, wie sein "Ketzer von Soana" mit dem echten Ketzertum in Verbindung gebracht werden darf. Am Fehlurteil ist die Verbürgerlichung der Christenheit schuld, die ein verhüllter Feind der Evangelien ist, während der Gotteshass des Kommunismus offenkundig ist. Die bourgeoise Christentum-Auffassung ist eine schleichende Krankheit, die mit ihren Tendenzen eine unmerkliche Verfälschung betreibt, die sie selbst kaum erkennt. Vom christlichen Narren kann man lernen, dass der Heilige keine leere, langweilige Gestalt darstellt, sondern von einer Radikalität erfüllt ist, die ins Fleisch schneidet. Er ist von der christlichen Torheit ergriffen und steht in scharfem Gegensatz zu Gottes Bodenmannschaft, die vorwiegend darauf schaut, wie man eine Sache am besten schaukelt, damit sie möglichst vielen genehm ist. Der christliche Narr vollzieht eine viel radikalere Umwertung, als Nietzsche sie postulierte. Dies hat Franziskus begriffen, zu dem Gott ausdrücklich sagte, dass er ein Tor in der Welt sein solle.
Dazwischen fing ich mit dem katholischen Priester Wilhelm Schamoni zusammen an, die Reihe Heilige der ungeteilten Christenheit (1962-1969) herauszugeben. Schamoni war der Verfasser des schönen Buches "Das wahre Antlitz des Heiligen" und verfügte über eine große Kenntnis der Heiligenwelt. Wir legten Wert darauf, die Heiligen von Augenzeugen geschildert zu sehen und griffen immer auf die älteste Vita zurück. Im Ganzen gaben wir neunzehn Bände heraus, von denen ich sechs bearbeitete (Niklaus von Flüe, Elisabeth, die russischen Mönchsväter, Chrysostomus, Seuse, Hedwig). Dann geriet der Verlag in finanzielle Schwierigkeiten und brach die Reihe abrupt ab, ohne uns Herausgebern vorher nur ein Wort zu sagen. Mein Plan war, die Grenzen der ungeteilten Christenheit zu überschreiten und auch Viten aus dem 16. und 17. Jahrhundert herauszugeben. Aber daraus wurde nach dem verlegerischen Fiasko nichts.
Das Buch Glanz der Legende (1964) trägt den Untertitel "Eine Aufforderung, die Einfalt wieder zu lieben". Es steht in einem deutlichen Zusammenhang mit den "christlichen Narren", welche die höhere Einfalt auf eine ungewöhnliche Weise realisierten. Natürlich wusste ich, dass die Legende bei den meisten Historikern suspekt war und in ihrem rationalen Weltbild keinen Platz hatte. Wenn etwas legendär überliefert war, hieß das für sie: Es ist so viel wie nicht wahr, die geschichtliche Überlieferung ist äußerst fragwürdig. An diesem Augenzwinkern der Historiker beteiligte ich mich nicht, sie schien mir eine Einstellung mit Scheuklappen. Mit diesem Vorurteil brach ich entschieden und schrieb zu dem Buch eine Einleitung "Legenden in legendarischer Sicht". In der Welt der Heiligen spielen nun einmal Legenden eine große Rolle, und wer Hagiographie betreiben will, muss die Kunst Legenden zu lesen ganz neu lernen. Gewisse Legenden bringen das Wesen eines Heiligen unüberbietbar zum Leuchten. In den "Fioretti" sind beispielsweise Partien enthalten, die wohl die Gestalt des Poverello ganz zu innerer Anschauung bringen. Bei den Legenden hat nicht die Frage nach der Historizität primäre Bedeutung, vielmehr kommt es eindeutig auf ihren Sinn an. Als ich an die Niederschrift des Buches ging, fragte ich jeden Katholiken, der mir über den Weg lief, ob er mir die Legende der Katharina oder die des Georg erzählen könne. Die meisten blickten mich verdutzt an, aber einmal erwiderte mir eine überzeugte Katholikin: "Das weiß ich nicht, aber dies hätte Ihnen meine Großmutter genau erzählen können." Dass die Großmutter die Legenden noch kannte, glaubte ich ohne weiteres, aber der heutige Christ weiß von ihnen kaum noch etwas. Ist dies nicht das Zeichen einer geistigen Verarmung? Geht nicht das christliche Erbe unmerklich immer mehr verloren? Diesem unaufhaltsamen Verlust musste doch entgegen gewirkt werden.
Zwei Jahre darauf ließ ich dem Thema ein neues Buch folgen: Unvergängliche Legenden (1966). Es waren Kunstlegenden, die meine Frau Gert und ich einen ganzen Winter lang aus der neueren Dichtung zusammen suchten und mit denen dargetan werden sollte: Die Legende ist nicht bloß eine mittelalterliche Angelegenheit, sondern eine literarische Gattung aller Zeiten, die auch moderne Schriftsteller und Leser gleichermaßen beschäftigt. Auf sie kann nicht verzichtet werden, wenn man nicht die christliche Anschaulichkeit preisgeben will. Eine Legende wie "Das Zwiebelchen" versteht auch der einfachste Mensch, was man von den systematischen Abhandlungen doch nicht behaupten kann.
Wenige Jahre hernach gab ich Bildbände (ab 1975) von Heiligen heraus, insgesamt zehn Bände (Franziskus, Niklaus von Flüe, Elisabeth, Martin, Benedikt, Theresa von Avila, Thomas Morus, Katharina von Siena, Antonius von Padua, Maximilian Kolbe). Freilich war ich mit ihnen nicht zufrieden. Der gewalttätige Lektor des Verlages schrieb mir die Seitenzahl vor, wählte die Bilder selbstherrlich aus und funkte mir in verschiedener Beziehung hinein. Es war alles andere als eine erfreuliche Zusammenarbeit. Die schönen Bilder erinnerten zuweilen an Reiseprospekte und standen oft zum Text im Widerspruch. Schließlich lehnte ich die weitere Mitarbeit ab, obschon ich noch etliche Texte in der Schublade bereit hielt.
An hagiographischen Arbeiten erwähne ich noch Das Buch der Büsser (1970). Es war ein unzeitgemäßer Titel und Inhalt. Doch Christus trat nun einmal mit dem Ruf auf: Tut Buße! Die Umkehr bildet das Eingangstor zum Evangelium. Den Zeitgenossen lag das Thema fern, sie wollten nicht auf die große Aufforderung eingehen. Umso stärker wirkte es auf mich. Mir gab es Gelegenheit, auf einige Heilige hinzuweisen, die man in den Winkel gestellt hatte, während doch der radikale Bruch in ihrem Leben überaus bedeutsam ist. Wiederum erschien mir der Heilige als der außerordentliche Mensch, der die Gewöhnlichkeit hinter sich gebracht und einen Schritt getan hat, der nicht so ohne weiteres nachgeahmt werden kann. Mögen die Büßer auch als altmodisch abgetan werden - dieses ebenso gedankenlose wie hochnäsige Urteil hat gar nichts zu besagen. Sie sind und bleiben die Menschen, die mit Christi Aufruf zum überrationalen Leben ganz Ernst gemacht haben. Übersehe man doch nicht, dass Franziskus und seine Mitbrüder "Büßer von Assisi" genannt werden. Mit dieser Umkehr begann das Wunder des Poverello, das ebenso fasziniert wie unfasslich ist.
Es würde langweilig wirken, wenn ich alle Heiligenbücher näher charakterisieren wollte. Der verborgene Glanz (1971), Vom beispielhaften Leben (1974) und Heilige im Alltag (1976) folgten aufeinander. Sie alle bezeugen meine unvorstellbare Liebe zur Hagiographie, an der ich immer persönlich und nie bloß wissenschaftlich beteiligt war.
Ein besonderes Wort erfordert das Buch Heilige ohne Heiligenschein (1978), womit ich meine Darstellung auf die unkanonisierten Heiligen ausdehnte. Längst war mir klar geworden, dass nicht nur die Menschen heilig sind, die durch den amtlichen Heiligsprechungsprozess hindurch gegangen waren. Es gibt in der Geschichte der Christenheit auch anonyme Heilige, die an Wert nicht hinter den offiziellen Heiligen zurückstehen. Die Kirche hat auch nie behauptet, dass nur die heilig seien, die sie kanonisiert habe. Auch die Ostkirche und der Protestantismus haben Heilige hervorgebracht, die nicht weniger in ihrer Verborgenheit leuchten. Der Christ darf nicht nur amtlich denken, das ist nicht originell und entspricht schon gar nicht dem Evangelium. Man muss auch den Mut haben, die Dinge unabhängig anzuschauen. Das ist oft viel notwendiger, als das Übliche zum zehnten Mal zu sagen. Natürlich hat diese private Heiligsprechung - ich betrieb sie schon in "Große Heilige" mit den vorbildlichen Gestalten Gerhard Tersteegen und Niklaus von Flüe (der zu jener Zeit von Rom noch nicht kanonisiert war) - auch gewisse Gefahren: Das subjektive Urteil kann täuschen. Doch handelt es sich hierin nicht um eine persönliche Vorliebe, sondern ich wollte dem verhüllten Heiligen nachspüren, dem die offizielle Anerkennung nicht zuteil wurde. Unter ihnen gibt es ganz herrliche Frauen und Männer, ja die Heiligen ohne Heiligenschein tragen zu einer wünschenswerten Ausweitung der Hagiographie bei.
Immer von einer neuen Seite versuchte ich das Thema des Heiligen anzugehen, doch kam ich damit nie zu Ende. Es gibt viele Menschen, die nie nach einem Heiligenbuch greifen, sei es, dass ihnen das Thema in der Jugend durch fromm die Augen aufschlagende Personen verleidet wurde, oder dass sie sich darunter nur gänzlich veraltete Geschichten vorstellen können. Sie wollte ich durch das Buch Große Unheilige (1980) ansprechen und auf diesem Umweg für das Thema interessieren. Selbstverständlich standen für mich Heilige und Unheilige nicht auf der gleichen Stufe. Das wäre eine Verneinung der Ordnung. Doch werden die Unheiligen bei mir vom Standort der Heiligkeit und nicht etwa von dem der Unheiligkeit aus beleuchtet. Damit ist jedoch keineswegs eine Verdammung der Unheiligen verbunden. Dies kann niemals das Amt des Hagiographen sein. Mit gewissen Unheiligen verband mich eine tiefe Sympathie (Héloise, Baudelaire, Nietzsche). Unsympathisch war mir dagegen Bakunin, den ich nur deswegen einbezogen hatte, um an ihm einer dem Linksdrall verfallenen Jugend zu zeigen, wie phraseologisch die revolutionären Führer waren, wenn man sie näher studiert. Die Hagiographie muss so weit gefasst werden, dass auch die Gegenspieler der Heiligen ins Gesichtsfeld gerückt werden. Sie gehören in ihren Bereich. Damit ist freilich die Grenze der traditionellen Hagiographie überschritten. Dadurch aber erhält alles schärfere Konturen, und zugleich bleibt man eingedenk, dass man sich mit ihr nicht auf eine Insel der Seligen geflüchtet hat.
Die Hagiographie habe ich als das Thema meines Lebens bezeichnet. Das ist sie tatsächlich auch, wenn man die Anzahl der Bücher zählt, die ich bis zuletzt über die Heiligen geschrieben habe, wobei ich noch an die Biographien über Don Bosco (1977) und Mary Ward (1983) erinnern darf. Abschließend bewerte ich meine hagiographische Beschäftigung als einen bescheidenen Neuanfang auf diesem Gebiet. Ich hoffe nicht nur, dass andere Hagiographen kommen, welche diese Thematik fortsetzen, sondern dass diese es noch viel besser machen, als ich es vermochte. Die neue Heiligenerfassung steht erst am Anfang und noch lange nicht am Ende. Bei den Heiligen geht es im Grunde doch um das, was sich nicht ausdrücken lässt. Sie denken und reden von dem, was zwischen den Worten schwingt. Das bedeutet nicht etwas Diffuses, wohl aber, dass der Heilige immer und unter allen Umständen über seinem Darsteller steht. Er lässt sich nie mit Worten einfangen. Dem Heiligen ist begrifflich nicht beizukommen, das höhere Gefühl erahnt ihn nur bis zu einem gewissen Grade. Dies sei der zukünftigen Hagiographie ins Stammbuch geschrieben.