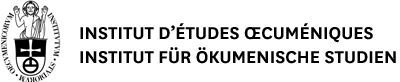Autobiographisches
Erwin Iserloh
Lebensrückblick
aus: Römische Quartalschrift 82 (1987) 15–43
Im Jahre 1915 wurde ich als jüngster von drei Söhnen geboren. Meine frühesten Erinnerungen reichen bis in die Zeit des Ersten Weltkrieges. Unvergessen bleibt mir der Abschied meines Vaters in feldgrauer Uniform von meiner Tante auf dem Treppenabsatz unserer Wohnung in Duisburg-Beeck. Oder ich sehe vor mir, wie meine Mutter die Gaslampe entzündet, um uns eine Feldpostkarte meines Vaters vorzulesen, auf der rumänische Frauen beim Waschen abgebildet waren. Der erste Tote, dem ich in meinem Leben begegnete, war ein junger Reichswehrsoldat, Opfer eines Gefechtes mit den Spartakisten. Auf einem Planwagen ausgestreckt, starrte er mich mit seinen toten Augen an, als ich neugierig vom ersten Stock auf die Straße hinabblickte.
Elternhaus – Schule – Bund Neudeutschland
Im Schatten der Kirche des hl. Laurentius in Duisburg-Beeck wuchs ich heran. Die Pfarrgemeinde war eine 1901 kanonisch errichtete, schnell wachsende Industriegemeinde, die damals schon 5320 Katholiken zählte und deren Zahl bis 1911 auf 9122 und bis 1923 auf 12'000 anstieg.
Mein Vater (geb. 18. Juli 1874) war dort seit dem 12. August 1894 als Lehrer an der Knabenschule tätig. Er übernahm 1913 die Leitung der neu eingerichteten kath. Hilfsschule – heute Sonderschule – als Hauptlehrer. Hier blieb er bis zu seiner vorzeitigen Pensionierung durch die NS-Regierung im Jahre 1937 tätig. Wegen seines unermüdlichen Einsatzes in Schule und Pfarrei, wegen seiner hohen Bildung und vornehmen Zurückhaltung war er hochgeschätzt und beliebt. Mit dem in der Präparandie und im Lehrerseminar Gebotenen war sein Bildungshunger nicht gestillt. Seine geistige Linie ist vielleicht am besten gekennzeichnet durch das „Hochland", das er vom ersten Heft an bezog, eifrig las und mit dem er auch seine Söhne bekannt zu machen bemüht war. Das akademische Studium, das ihm selbst verwehrt war, suchte er ihnen zu ermöglichen. Das bedeutete eiserne Sparsamkeit in der Lebensführung der Eltern, zu der die Söhne ebenfalls angeleitet wurden.
Stellten diese gelegentlich unerfüllbare Ansprüche, pflegte meine Mutter zu sagen: „Da hättet ihr in der Wahl eurer Eltern vorsichtiger sein müssen!" Nur unter Opfern – ohne „Honnefer Modell" oder „Bafög" – konnte ein akademisches Studium ermöglicht werden. Motivation für überdurchschnittliche Leistungen in der Schule war auch das Bestreben, zur Überwindung des später sprichwörtlich gewordenen Bildungsdefizits der Katholiken beizutragen. Eine mittelmäßige Klassenarbeit war für meinen Vater schon Anlass genug zu der Bemerkung: „Müssen die Protestanten denn immer die Tüchtigeren sein?"
Dabei war in der Oberstufe die Schule für mich weithin Nebensache. Vielmehr hat mich die Tätigkeit im Jungenbund „Neudeutschland" in Anspruch genommen. Die Nachmittage und manchen Abend verbrachte ich im „Heim" in Duisburg, so dass ich zu Hause kaum zu sehen war. Meine Eltern nahmen das großzügig hin. Wurde es gelegentlich zu toll, dann machten sie höchstens die ironische Bemerkung, ich sollte mir doch in Duisburg eine Wohnung mieten. Der elterliche Wohnsitz war der Vorort Beeck, ca. 5 km vom Zentrum Duisburgs entfernt.
Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus
Die letzten Jahre des Gymnasiums waren voller Spannungen durch die Auseinandersetzungen mit der NS-Ideologie und der Hitlerjugend.
Noch am Abend vor dem mündlichen Abitur (1934) kam es zu Handgreiflichkeiten mit der Hitlerjugend; sie hatte Werbeplakate an die Wände unseres „Heimes" geklebt, welche wir wieder entfernten. Mein Freund Fred Quecke lenkte den Angriff auf sich ab, so dass ich mich entfernen konnte. So brauchte man mich nicht am nächsten Morgen aus dem Polizeigefängnis zur Prüfung in die Schule bringen. Vater und Söhne gaben nach Kräften ihrer Ablehnung des Nationalsozialismus Ausdruck. Am Tag der letzten demokratischen Wahl, am 5. März 1933, wehte auf dem Balkon unserer Wohnung die schwarz-rot-goldene Fahne. Das erregte nicht wenig Aufsehen, weil wir dem Hauptportal der Kirche gegenüber wohnten und die Kirchenbesucher, ob sie wollten oder nicht, das Symbol der Demokratie zur Kenntnis nehmen mussten. Nicht auf den Druck der Straße, sondern erst auf die Bitte der Polizei hin erklärte mein Vater sich bereit, die Flagge einzuziehen. Mein Bruder Leo begleitete diese Szene mit einer kurzen Rede: Jetzt muss sie dem Terror weichen. Doch es wird der Tag kommen, an dem diese Fahne wieder in Ehren flattern wird.
Studium in Münster
Ostern 1934 genügte das Abiturzeugnis nicht für die Zulassung zum Universitätsstudium; es bedurfte eigens der „Hochschulreife", die auf Vorschlag der Schule durch eine höhere Stelle verliehen wurde. Damit sollte angeblich eine Überfüllung der Universitäten verhindert werden. Praktisch war es ein Mittel, politisch nicht genehme „Elemente" von den Hochschulen fernzuhalten. Obwohl ich von meiner Schule – dem Landfermann-Gymnasium in Duisburg – an erster Stelle vorgeschlagen war, da ich das beste Zeugnis hatte, wurde mir die Hochschulreife verweigert. In den Genuss der Ausnahmeregelung für das Studium der Theologie kam ich auch nicht, weil ich angesichts des Andrangs zum Priestertum von der bischöflichen Behörde wegen meines verhältnismäßig jugendlichen Alters zurückgestellt wurde. Damit blieb mir ein „Sabbatjahr", in dem ich mich als Jugendführer betätigte, aber auch viel und – wie ich im Rückblick beurteilen kann – sinnvoll ausgewählt las: Platons „Staat", Karl Adam, „Das Wesen des Katholizismus", Josef Pieper „Vom Sinn der Tapferkeit", Franz-Michel Willam „Das Leben Jesu im Lande und Volke Israel", alles Erreichbare von Romano Guardini, Theodor Haecker u.a. mehr.
Mit dem Sommersemester 1935 konnte ich endlich das Studium der Theologie in Münster beginnen. Maßgebend und richtungsweisend waren für mich die Professoren Peter Wust und Joseph Lortz, in den höheren Semestern vor allem Michael Schmaus. Mit viel Gewinn habe ich dazu regelmäßig die Vorlesungen des Germanisten Günther Müller gehört; u.a. hat er mir den Zugang zum Verständnis des Barock eröffnet. Von den Professoren der Evangelisch-Theologischen Fakultät hörte ich mehrere Semester hindurch Wilhelm Stählin, den späteren Landesbischof von Oldenburg. Er war Professor für Pastoraltheologie. Führend im „Berneuchener Kreis", hatte er großes Verständnis für Gottesdienst und Sakramente und wusste Interesse dafür bei seinen Hörern zu wecken.
Begleitet von dem Spott meiner Konsemester, denen das als zu hoch gegriffen erschien, wagte ich mich schon im 1. Semester in das Seminar von Peter Wust, in dem die „Krankheit zum Tode" von Sören Kierkegaard behandelt wurde. Zu Peter Wust bahnten sich bald engere Beziehungen an. Das Oberseminar in seiner Privatwohnung stand mir offen, und auch an der „Akademie von Mecklenbeck" durfte ich teilnehmen. Es handelte sich dabei um den regelmäßigen Spaziergang am Samstagnachmittag nach Mecklenbeck, wo wir in der Wirtschaft Lohman einkehrten.
Hier las Wust während der Monate der Niederschrift seines Buches „Ungewissheit und Wagnis" aus dem Manuskript vor. Sonst lasen und diskutierten wir Texte die irgendwie aktuell waren; ich erinnere mich z. B. an Novalis „Die Christenheit oder Europa".
Im 5. Semester ließ ich mir von Peter Wust das Thema einer Doktorarbeit geben. Es lautete: „Der theologische Irrationalismus bei Petrus Damiani". Dieser als Heiliger verehrte Mönch, Kirchenreformer und Kirchenlehrer aus dem 11. Jahrhundert hat die Allmacht Gottes so weit übersteigert, dass er ihm die Macht zuschrieb, Geschehenes ungeschehen zu machen, etwa einer Frau die ursprüngliche Jungfräulichkeit wiederzugeben.
Bevor ich diese Arbeit ernsthaft in Angriff genommen hatte, kam es zu einem Zerwürfnis mit dem „Doktorvater". In einem Seminar über die Gottesbeweise bei Immanuel Kant hatte ich meine abweichende Meinung nach dem Empfinden des Professors, dessen starke Seite ohnehin die Diskussion nicht war, zu hart und selbstbewusst vertreten. Er gab seinem Unwillen darüber sehr entschieden Ausdruck. Nach dieser Auseinandersetzung sah ich – mehr oder weniger zufällig – am Schwarzen Brett der Universität eine Preisarbeit ausgeschrieben zu dem Thema „Der Kampf um die Messe in den ersten Jahren der Auseinandersetzung mit Luther". Diese Verbindung von Kirchengeschichte und Dogmatik lag mir ohnehin. So beschloss ich, die philosophische Arbeit zunächst einmal zurückzustellen und mich dieser Preisarbeit zuzuwenden. Sollte mir der Preis nicht zugesprochen werden, dann konnte ich – so lautete mein Kalkül – mit dieser Arbeit zumindest die von der Prüfungsordnung geforderte „wissenschaftliche Arbeit" abdecken.
Die Preisarbeit gab ich zum Ende des Sommersemesters 1937 ab, zu Beginn des Wintersemesters 1937/38 wurde mir der Preis verliehen. Die Angelegenheit hatte bis dahin geheim bleiben können, weil man im „Borromaeum" keinen Bearbeiter des Themas im 3. Kurs vermutete. An Preisarbeiten beteiligten sich normalerweise nur Studenten des 4. Kurses, d.h. des 7. bis 8. Semesters. Für mich war dieser Lauf der Dinge von Bedeutung, weil damit der Übergang zur Kirchengeschichte angebahnt war.
Priesterweihe – Promotion – Jugendarbeit
Die engeren Kontakte zu Professor Lortz sollten diese Entwicklung noch fördern. Er wurde bei meinem Bischof Clemens August von Galen vorstellig mit dem Wunsch, man möge mich nach der Priesterweihe (14. Juni 1940) zum Weiterstudium beurlauben. Eine solche Beurlaubung unmittelbar nach der Priesterweihe widersprach der sehr sinnvollen Praxis der Bistumsleitung, Neupriestern, die man zum Weiterstudium vorgesehen hatte bzw. die sich darum bemühten, zunächst für mindestens zwei Jahre eine Kaplanstelle zu übertragen und ihnen so Gelegenheit zu geben, sich erst einmal in der ordentlichen Seelsorge zu bewähren. Diesem Grundsatz entsprach der Bischof, indem er mich zum Kaplan in Laer bei Burgsteinfurt, einer Gemeinde von ca. 3000 Katholiken, ernannte; er handelte ihm entgegen, insofern er mir gleichzeitig den Auftrag oder die Erlaubnis gab, mich auf die Promotion vorzubereiten. Erkundigungen über diese Stelle ergaben u.a., dass ich auch den Religionsunterricht in einem Progymnasium zu übernehmen hatte. Das bestärkte mich in dem Vorsatz, mich ganz der Seelsorgsarbeit zu widmen und bei nächster Gelegenheit dem Bischof mitzuteilen, ich sei mit der Stelle bestens zufrieden; an die Vorbereitung einer Promotion sei aber nicht zu denken. Es sollte jedoch anders kommen.
Am frühen Nachmittag des Vortages von Peter und Paul, am 28. Juni 1940, fuhr ich mit dem Autobus nach Laer, um die neue Stelle anzutreten. Als ich mit zwei Koffern und einer Schreibmaschine beladen die Treppe zum Pfarrhaus hinaufstürzte, öffnete sich die Tür, und vor mir stand gebieterisch eine große Frau, musterte mich recht kritisch und fragte mit strenger Miene: „Haben Sie unseren Brief nicht bekommen?" Es war die Schwester und zugleich Haushälterin des Pastors. In „unserem Brief", der mich nicht erreicht hatte, stand geschrieben, ich brauchte nicht zu kommen, man hätte anderweitig Hilfe gefunden. In das Arbeitszimmer des Pfarrers geführt, begegnete ich einem Pfarrherrn, der noch wortkarger war. Er bot mir einen Stuhl an, ging mit großen Schritten im Zimmer hin und her und knurrte etwas zwischen den Zähnen, das mir als Kritik an der Bischöflichen Behörde erschien. Schließlich schaute er auf die Uhr – es war ca. 14 Uhr –und stellte fest: „Der Autobus ist weg." Auf diese indirekte Weise wurde mir klargemacht, dass man auf meine Dienste verzichtete. Weitere Erklärungen über die Mitteilung hinaus, dass er ein Taxi bestellen würde, das mich gegen 18.00 Uhr zum Zug an den Bahnhof Altenberge bringen sollte, hielt der Pfarrer für überflüssig. Nur als ich die Absicht äußerte, die Kirche zu besichtigen und mich im Dorf etwas umzusehen – ich wollte eine mir gut bekannte Familie besuchen –, wurde mir bedeutet, ich hätte das Pfarrhaus nicht zu verlassen. Auch in dieses Schicksal, drei bis vier Stunden in dem ungemütlichen Zimmer zu hocken, fügte ich mich, muckte auch nicht auf, als man mir einen Zwei-Mark-Schein in die Hand drückte – Fahrgeld, das nur bis Münster reichte, obwohl ich von Duisburg gekommen war und wieder dorthin zurück wollte. Als ich mich beim Regens zurückmeldete und von meinem Geschick erzählte, reagierte er mit der Bemerkung: „Ja, ein aparter Herr, dieser Pfarrer." Eigentlich etwas zu karg, um einem jungen Mann Mut zu machen. Doch wenn man Regens Franken kannte, wusste man, dass man bei ihm manches sein durfte, nur nicht „apart". Vielleicht sollte mir durch diese Verweigerung der Stelle klarwerden, dass man auf mich nicht gerade gewartet hattel dass das Reich Gottes auf mich nicht angewiesen war.
Für meinen weiteren Weg war diese Episode folgenschwer, weil ich nun in eine Studienstelle eingewiesen wurde. Ich wurde zum Kaplan am St.-Rochus-Hospital bei Telgte – der sogenannten „Hülle" – ernannt. Es handelte sich um eine Heil- und Pflegeanstalt für ca. 300 Frauen. Der Anstaltspfarrer war alt und gebrechlich. Mir oblag es, den Gottesdienst an frühen Morgen um 5.25 Uhr für die Schwestern zu halten und an Sonn- und Feiertagen zu predigen. Die Kranken zu besuchen, war nur begrenzt möglich. So blieb mir genügend Zeit, an meiner Dissertation zu arbeiten und dazu in Münster auch noch an Vorlesungen und Seminaren im Fach Geschichte teilzunehmen.
Das Thema meiner Doktorarbeit „Die Eucharistie in der Darstellung des Johannes Eck. Ein Beitrag zur vortridentinischen Kontroverstheologie über das Messopfer" ist eine Konkretisierung und Vertiefung der Preisarbeit „Der Kampf um die Messe". Hier hatte ich in Kürze gezeigt, dass Luther die Messe als Opfer ablehnen, ja für Götzendienst halten musste, weil er sie als ein „Wiederkreuzigen", als eine historische Wiederholung des Kreuzesopfers verstand, das doch nach dem Hebräerbrief einmal und ein für allemal dargebracht war. Im Rahmen der nominalistischen Denkstruktur des Reformators war für eine Gegenwärtigsetzung des einmaligen Opfers unter dem sakramentalen Zeichen, war für ein Realsymbol, für ein Tatgedächtnis kein Platz. Die altkirchlichen Theologen wiederum – Kaspar Schatzgeyer ausgenommen – vermochten aus demselben Grund das Messopfer nicht so zu verteidigen, dass dem reformatorischen Anliegen Genüge getan war. Das sollte in der Doktorarbeit an der Gestalt und dem Werk des unermüdlichen Streiters Johannes Eck näher aufgewiesen werden. Für Eck besteht die Einheit des Opfers in der Identität der Opfergabe, aber nicht auch des Opferaktes. Statt zu argumentieren: Messe und Kreuzesopfer sind eins; das eine Opfer am Kreuz werde sakramental, d.h. unter dem Zeichen von Brot und Wein gegenwärtig, führt Eck aus: Paulus spreche im Hebräerbrief nur vom blutigen Opfer am Kreuz, das Messopfer sei in dem „ein für allemal" weder mitgemeint noch ausgeschlossen. Die wiederholte, unblutige Darbringung von Leib und Blut Christi sei als alia oblatio, als alterum sacrificium vom Kreuzesopfer zu unterscheiden. Auf einen schwerwiegenden Einwand der Reformatoren vermochte Eck damit bei allem gelehrten Aufwand keine hinreichende Antwort zu geben.
Meine Dissertation reichte ich im Sommersemester 1942 ein und bat um einen Termin für das Rigorosum noch vor den großen Ferien. Ich wollte die Promotion abgeschlossen wissen, bevor ich zum Militärdienst eingezogen wurde, womit ich jederzeit rechnen musste. Mitten in den Vorbereitungen auf das Rigorosum – damals umfasste es noch je eine einstündige Prüfung in 8 Fächern der Theologie – wurde ich am 26. Mai 1942 zum Präses in der „Knabenerziehungsanstalt St. Josefshaus" bei Wettringen ernannt. Es handelte sich dabei um eine selbständige Seelsorgstelle; dadurch war ich vor der Einberufung zur Wehrmacht bewahrt. Im Josefshaus wurde mir als näherer Tätigkeitsbereich der „Heidhof" übertragen. Hier hatte ich mehrfach straffällig gewordene Jugendliche im Alter von 17 bis 21 Jahren außerhalb der Arbeitszeiten, also beim Essen, beim Unterricht und beim Spiel, zu betreuen bzw. zu beaufsichtigen. Diese Abteilung war von den anderen isoliert in einem eigenen Gebäude untergebracht. Die Jungen schliefen in von außen abgeriegelten Einzelzellen. Das Ganze machte nicht gerade einen freundlichen Eindruck. Ich kam mit den Jungen aber ganz gut zurecht. Ausgesprochene Freude machte mir die Erteilung des Religionsunterrichtes in der Schule der Anstalt. Bischof Clemens August von Galen, der anlässlich der Firmung auch die Schule besuchte, wollte kaum glauben, dass es sich bei den Schülern, die sich so lebendig und aufgeweckt am Unterricht beteiligten, im Grunde um Hilfsschüler handelte.
Die pädagogische Fürsorge des Bischofs galt nicht nur den Fürsorgezöglingen, sondern auch dem jungen Präses und angehenden Doktor der Theologie. Dem Direktor der Anstalt gegenüber äußerte der Bischof, er habe gemeint, nachdem ich mich immer mit Gymnasiasten beschäftigt hätte, sollte ich mich auch einmal Jugendlichen dieser Herkunft und Veranlagung widmen.
Flucht vor der Staatspolizei
Lange sollte ich dazu aber nicht die Gelegenheit haben. Denn inzwischen war die Geheime Staatspolizei in Münster auf die Jugendarbeit aufmerksam geworden, mit der ich mich fast zwei Jahre lang befasst hatte und die sie als Fortsetzung der Arbeit im Jahre 1939 verbotenen Bund „Neudeutschland" ansah. In der Tat hatten wir im Verborgenen ein lebendiges Gruppenleben aufgebaut. Die „Fähnlein" von jeweils 8 bis 10 Jungen hielten in Privatwohnungen ihre Gruppenstunden ab, durchstreiften zu Fuß oder mit dem Fahrrad die Umgebung. Sonntags kamen sie gruppenweise zu mir heraus nach Telgte, wo sie von den Schwestern großzügig bewirtet wurden und wo Gelegenheit zu Einkehrtagen war. Diese wurden aufgelockert durch Ballspiel in einem der Höfe, die sonst den Kranken zur Erholung dienten. Im Rückblick erscheint dieses Tun voller Risiken. Ich war mir aber damals durchaus der Verantwortung gegenüber Eltern und Jungen bewusst und habe deshalb z.B. einmal eine Versammlung von Eltern einberufen, um sie auf die Gefahr aufmerksam zu machen. Ausgerechnet ein Feldpostbrief, der mit der Aufschrift „Gefallen für Großdeutschland" zurückkam und der Gestapo bei einer Hausdurchsuchung in die Hände fiel, ließ die Arbeit auffliegen. In dem Brief schilderte ein Junge seinem ehemaligen Fähnleinführer in aller Ausführlichkeit mit Nennung der Namen das Gruppenleben, in der Meinung, einem Feldpostbrief könne man das alles anvertrauen. Die Gestapo hatte so Hinweise, um die Namen und die Wohnungen der führenden Jungen auszumachen, Hausdurchsuchungen ergaben weiteres Material.
Ich war damals schon Präses in Wettringen, doch die Untersuchungen konzentrierten sich immer mehr auf meine Person. Was war zu tun? Für welche Initiativen war noch Raum?
Bevor ich am 8. Dezember 1942 meinen Bischof aufsuchte, feierte ich im Mutterhaus der Franziskanerinnen die hl. Messe. Mein Messdiener war Fritz Rothe, der als Sonderführer im Luftgaukommando am Hohenzollernring tätig war. Beim anschließenden Frühstück haben wir beratschlagt und kamen überein, dass ich mich nicht zur Wehrmacht melden sollte, obwohl das damals ein Weg war, dem Konzentrationslager zu entgehen. Sollte man als Soldat doch belangt werden, dann erhielt man wenigstens ein ordentliches Gerichtsverfahren.
Wie sich später bei der Voruntersuchung herausstellte, lautete die Anklage auf Fortführung illegaler Verbände und auf Zersetzung der Wehrkraft. Einem Jungen, dessen Tagebuch mit entsprechenden Notizen der Gestapo bei einer Hausdurchsuchung in die Hände fiel, hatte ich geraten, sich nicht freiwillig zur Wehrmacht zu melden, sondern zuerst das Abitur zu machen. Dann brauche der Führer auch noch Soldaten. Zu der beanstandeten Gruppenarbeit hatte man ins Einzelne gehendes, reiches Material gesammelt.
Sanitätssoldat
Die Unterredung mit dem Bischof am 8. Dezember verlief ziemlich dramatisch. Unverblümt versicherte ich ihm, ich hielte es für ehrenvoller, im Konzentrationslager umzukommen, als für das Großdeutsche Reich in Russland zu fallen. Der Bischof war über meine kaltschnäuzige Art ziemlich entsetzt. Er unterschied damals noch zwischen dem NS-Regime und dem Krieg gegen den gottlosen Bolschewismus, der Mitteleuropa zu überfluten drohte. Meine Antwort darauf lautete: „Exzellenz, dann müssen Sie mir den Stellungsbefehl besorgen. Ich möchte in dieser Sache nicht aktiv werden."
Für die nächsten Tage mied ich das Josefshaus und wohnte im Martinistift in Appelhülsen. Tagsüber besuchte ich Jungen, die bei Bauern des Münsterlandes in Dienst gegeben waren. Im Personenzug von Coesfeld nach Rheine übergab mir – ich glaube am 12. 12. 1942 – Prälat Leufkens den Stellungsbefehl für die 5. Sanitätsersatzabteilung 6 in Soest (Westfalen). Dank guter Beziehungen der bischöflichen Behörde zum Wehrbezirkskommando hatte der Stellungsbefehl außer der Reihe erwirkt werden können. Ich zog in Klerikerkleidung – zum Verwundern aller, die das beobachteten – in die Soester Kaserne ein, als dort gerade die Rekruten vereidigt wurden, die in den Wochen vorher die Grundausbildung erhalten hatten. So blieb mir der Eid auf den Führer erspart. Dank des Einsatzes eines Mitbruders – des späteren Pfarrers von Westerkappeln Franz Lückmann der auf der Schreibstube „mitmischte", wurde ich nicht sofort nach der Ausbildung als Krankenträger nach Russland abgestellt, sondern hatte die Gelegenheit, zunächst zum Sanitätsdienstgrad ausgebildet zu werden und den Führerschein in den Klassen 1 und 3 zu machen. Damit bestand Aussicht auf einen interessanteren und im Sinne der Seelsorge wirksameren Einsatz bei der Truppe.
So wurde ich erst im Herbst 1943 an die Ostfront abgestellt. Die Eisenbahn brachte uns über Gatæina hinaus bis Krasno-Selo unweit von Leningrad. Wir wurden sozusagen auf freiem Feld ausgeladen. Unser erster Blick fiel auf eine Bodenwelle, über und über bedeckt mit Kreuzen eines deutschen Soldatenfriedhofs. War es tröstlich oder erbitternd, hier festzustellen, dass dem NS-Regime, welches in der Heimat die Bekenner des Kreuzes verfolgte das Kreuz aus den Schulen verbannte, hier nichts anderes einfiel, als auf den Gräbern der Gefallenen das Kreuz wiederum zu errichten?
Bis zum Rückzug lagen wir in einem Vorort von Leningrad. Ein umgekippter Straßenbahnwagen bildete das letzte Hindernis vor der Stadt. Die Kräne im Hafen waren ein markantes Ziel für unsere Artillerie. Nachts schallte die Propaganda des Russen zu uns herüber und suchte die Landser mit dem Versprechen guter Verpflegung und sauberer Betten in gemütlichen Hotels zum Überlaufen zu bewegen. Die mehrstöckigen, ziemlich modernen Häuser der Wohnsiedlung, zwischen denen wir unsere Bunker hatten, lieferten uns mit ihren Parkbettböden bequem zu beschaffendes Brennholz. Eine kleine Gemeinde, darunter Theologiestudenten, fand sich, wenn es sich machen ließ, abends zur Eucharistiefeier in einem der Bunker ein. Wir Theologen fanden Zeit zu Gesprächen und gemeinsamer Lektüre. Dabei brachten wir es bis zum berühmten 11. Kapitel des 4. Buches der Summa contra Gentiles des hl. Thomas von Aquin. Wer sein Frontgepäck mit diesem verhältnismäßig dicken Buch belastet hatte, weiß ich heute nicht mehr.
Als Sanitätsdienstgrad und „Sankrafahrer" (Sanitätskraftwagenfahrer) war ich im Ernstfall so sehr mit Verwundeten beschäftigt, dass ich keine Gelegenheit hatte, einen scharfen Schuss abzugeben. Ich konnte aber als Priester vielen Sterbenden beistehen, ihnen die hl. Ölung spenden und ihnen versprechen, ihre Angehörigen zu benachrichtigen. Mehrfach kam ich in heikle Situationen, wenn etwa auf dem Rückzug zwischen Leningrad und Ostpreußen nervös gewordene Offiziere von Regimentsgefechtsständen oder andere rückwärtige Kommandos meinen Krankenkraftwagen zu beschlagnahmen versuchten, um ihren Rückzug mit Verwundeten leichter abwickeln zu können; ich machte dagegen geltend, meine Aufgabe sei es, möglichst nahe an die vorderste Linie heranzufahren, weil die Verwundeten dort die Transportmittel viel dringender brauchten. Mehrfach hat mich ein Offizier mit vorgehaltener Pistole gefügig machen wollen. Nach dem vielzitierten Grundsatz „Der letzte Befehl ist heilig" war allzuleicht der Tatbestand der Befehlsverweigerung gegeben. Vielfachen Fehlentscheidungen stand man als kleiner Landser ohnehin machtlos gegenüber. War es da hybrid, gelegentlich zu bedauern, keines eigenen Kommandos für wert befunden zu sein?
Der Rückzug ging in den ersten Monaten des Jahres 1944 von Leningrad über Luga bis Pleskau. Einen Heimaturlaub konnte ich aufgrund einer kleinen Operation am rechten großen Zeh um ca. einen Monat verlängern. Eine Rückkehr zu meiner Truppe war danach nicht mehr möglich, da sie inzwischen in Kurland eingeschlossen war. Ich kam zunächst zur Genesenden-Kompanie nach Hamm. Das bedeutete eine weitere Verlängerung des „Heimaturlaubs". In diesen Monaten wurde aber die Gestapo aktiv. Hatte man schon im Lazarett telefonisch nach mir gefahndet, dann erschien in Hamm bei der Genesendenkompanie eines Tages ein Staatsanwalt des Sondergerichtes (?) Dortmund, um mich wegen meiner illegalen Tätigkeit zu vernehmen. Er brachte einen großen Packen Akten mit, was den anwesenden Gerichtsoffizier zu der spöttischen Bemerkung veranlasste: „Na, bei ihnen scheint Bürokratie ja auch groß geschrieben zu sein." Er bekam die Antwort: „Hätte ich alles Material mitgebracht, dann hätte ein Pferdekarren nicht genügt." Zu Beginn stellte der Staatsanwalt die Frage, ob er das Protokoll in Stenographie aufnehmen dürfe. Meine Antwort: „Sie dürfen alles, nur nicht erwarten, dass ich Ihr Protokoll dann unterschreibe."
Das Verhör wurde sachlich geführt. Gelegentlich ließ der Verhörende sogar durchblicken, dass er nicht voll hinter dem stand, was er hier pflichtgemäß zu tun hatte. Ich habe ihm seine Aufgabe nicht sonderlich schwergemacht und mich nicht bemüht, das Geschehene zu vertuschen. Das wurde mir um so leichter, als in den Tagen vorher Bombenangriffe das Ruhrgebiet besonders schwer heimgesucht hatten. Der Staudamm der Möhnetalsperre war getroffen worden, das Wasser hatte ganze Dörfer überflutet. Ich war zum Katastropheneinsatz in Mülheim/Ruhr eingesetzt gewesen. Dabei hatten wir Verletzte bzw. Tote aus dem glühenden Schutt zu bergen gehabt. Ich hatte sozusagen noch den Geruch von verbranntem Menschenfleisch in der Nase. Da kam mir das Verhör als lächerliche Farce vor, und aus dieser Stimmung heraus war ich eher bekenntnisfreudig als auf Tarnung bedacht. Wie ich später erfuhr, ging es gar nicht um mich allein, sondern um eine Reihe von führenden Jugendseelsorgern; für die Erzdiözese Paderborn wurde z.B. Augustinus Reinecke ähnlich behelligt. Man wollte die gesamte kirchliche Jugendarbeit als illegal, als Fortführung verbotener Verbände hinstellen und sie damit vollständig abwürgen. Der Prozess wurde aber nicht durchgeführt, sondern vertagt bis zum siegreichen Ende des Krieges.
Den verhörenden Staatsanwalt traf ich einige Wochen später wieder. Inzwischen war er selbst Rekrut bei der Artillerie in Hamm. Es war an einem Samstagnachmittag, als Hamm schwer von einem Bombenangriff heimgesucht wurde. Ich hatte in dem Kinderkrankenhaus bei der Pfarrkirche St. Agnes zelebriert und nahm die Gastfreundschaft der Schwestern in Anspruch, um danach Beichte zu hören. Mehrere Brandbomben trafen das Krankenhaus, so dass bald der Dachstuhl brannte. Die Bomben waren nicht zu entfernen, zum Löschen fehlten die Hilfsmittel. So mussten wir uns darauf beschränken, die Kinder mit ihren Betten in Sicherheit zu bringen. Bald kam auch ein Zug aus der Artilleriekaserne Hamm als Katastropheneinsatz unter dem Kommando des Fähnrich Barking, des späteren Direktors der Zeche Walsum. Ich kannte ihn, weil er öfter bei der Messe ministrierte, zu der wir Priestersoldaten uns im Krankenhaus einfanden. Abends kam er im Gespräch mit einem anderen Offiziersanwärter auf das Geschehen am Nachmittag zu sprechen. Auf die Bemerkung: „Mensch, hast du den Iserloh gesehen, wie nass und verdreckt der bei der Rettungsarbeit geworden ist?" horchte ein Rekrut auf, der gerade ein Spind in die Stube der Fähnriche schaffte. Er mischte sich in das Gespräch ein und fragte, ob es sich bei Iserloh um einen katholischen Priester handele. Es war der Staatsanwalt, der mich vernommen hatte. Er wünschte mich zu sprechen. Offenbar wollte er auf das Verhör zurückkommen und u.a. deutlich machen, dass er dabei nur als Beamter seine Pflicht getan hatte, ohne das Verfahren für rechtens zu halten.
Das Gespräch wurde mit Hilfe des Fähnrich Barking ausgemacht, kam aber nicht zustande, weil ich inzwischen (Oktober 1944) wieder zur Ostfront abgestellt wurde.
Rückzug – Verwundung – Lazarett
Unsere neu aufgestellte Division bezog Stellung in der Nähe von Lomscha (Lomza) am Narew. Der Hauptverbandplatz und der Krankenkraftwagenzug lagen in der Gegend von Kolno und Johannisburg in den Südmasuren. Hier war ich 1936 mit meinem Studienfreund Otto Köhne gewesen. Damals waren wir begeistert gewesen von der Landschaft: Wald, Heide und Seen. Nun bot sich uns ein ganz anderes, eher unheimliches Bild. Hinter jedem Baum konnte der Tod lauern in Gestalt eines mit einer Maschinenpistole bewaffneten Russen. Als am 13. Januar 1945 die Winteroffensive im Osten begann, war es an unserem Frontabschnitt zunächst noch ruhig. Doch bald mussten wir den Rückzug in Richtung Nordwesten antreten. Es ging westlich an Allenstein vorbei auf das Frische Haff zu. Der Transport der Verwundeten wurde immer schwieriger, am Ende blieb uns nur noch ein Eisenbahndamm: ein Rad außerhalb, eins innerhalb der Schienen. Unvermeidlich bedeutete jede Schwelle eine schwere Erschütterung, die die Verwundeten aufschreien ließ.
Am Donnerstag, dem 22. März 1945, hatte ich in Rosenberg, dem Hafen von Heiligenbeil, Verwundete zur Überfahrt nach Pillau abgeliefert. Mein Beifahrer hatte sich schon vorher angesichts der schweren Luftangriffe in Sicherheit gebracht. Da traf mich ein Bombensplitter in die linke Leiste. Es gelang mir, unter einen mit Munition beladenen Panzerwagen zu kriechen und hier den Angriff abzuwarten, allerdings immer darauf gefasst, das mein schützendes Dach mit der Munition in die Luft gehen würde.
Als der Beschuss nachgelassen hatte und wieder eine Fähre von Pillau einlief, gelang es mir, kriechend, ohne das geringste Gepäck, einen Platz auf ihr zu erobern. Als wir uns der Anlegestelle von Pillau näherten, erkannte ich unter den dort beschäftigten Soldaten meinen Bruder Leo. Erfreut suchte ich ihn mit Rufen auf mich aufmerksam zu machen, was auch gelang. Er nahm sich meiner an und veranlasste meinen Transport ins Feldlazarett. Leo hatte an der Fähre die Kontrolle und sollte Soldaten, die sich zu drücken suchten, zurückschicken. In den letzten Wochen hatten unsere Truppenteile ziemlich nahe beieinander gelegen. Doch von einem kurzen Telefongespräch abgesehen war es uns bzw. Leo – als Offizier war er freizügiger – nicht gelungen, eine Begegnung zu ermöglichen. So erschien er mir jetzt, da ich seiner Hilfe dringend bedurfte, als ein Engel vom Himmel Bald darauf wurde er in der Schlacht um Berlin noch einmal eingesetzt. Er fiel am 3. Mai 1945 und fand sein Grab in Potsdam. „Wie unbegreiflich sind Deine Wege, o Herr!" Sollte er erst mich retten, bevor er selbst abberufen wurde? Weshalb mussten meine Brüder, die Frau und Kinder zurückließen, fallen, und ich blieb am Leben?
Die Verwundung bereitete mir zunehmend große Schmerzen im Bereich der linken Seite und des Unterbauchs. Sollte es ein Bauchschuss sein? Das bedeutete unter den gegebenen Umständen den Tod. Als Sanitätsdienstgrad wusste ich, dass Bauch- und Hirnverletzungen nicht mehr behandelt wurden.
Bei der oberflächlichen Untersuchung führte der Stabsarzt eine Sonde tief in die Wunde ein und bemerkte dann zu seiner Assistenz: „Hat keinen Zweck!" Er streute reichlich MP-Puder in die Wunde und ließ sie verbinden. Dieser Ausspruch „Es hat keinen Zweck" war vom Arzt wohl gemeint als „Es hat keinen Zweck, den Splitter zu entfernen", ich konnte bzw. musste es aber verstehen als „Hoffnungsloser Fall" – das um so mehr, als die Schmerzen stärker wurden. Nach zwei Tagen ließ ich durch Leo den Stabsarzt bitten. Ich wollte Klarheit über meinen Zustand haben. Es entspann sich folgender Dialog: „Herr Stabsarzt, ich weiß, Priester und Nonnen sind schwierige Patienten." Er: „Sagen Sie das nicht, Kollegen sind viel schwieriger." „Ich will etwas von meinem Tod haben. Sagen Sie mir bitte klar und deutlich, wie es um mich steht." „Sie haben keinen Grund zur Beunruhigung. Der Splitter hat zwar den Trochanter verletzt, aber zum Glück ist weder das Gelenk in Mitleidenschaft gezogen, noch die Schlagader getroffen, noch ist der Splitter in die Bauchhöhle gedrungen. Wohl scheint sich eine Phlegmone, d.h. eine Zellgewebsentzündung anzubahnen."
Diese stellte sich auch bald ein, so dass am Palmsonntag, dem 25. 3., eine Operation bzw. ein Eingriff nötig wurde. Ein Schnitt in die Bauchdecke von ca. 20 cm sollte Erleichterung schaffen. Mehr konnte man angesichts des Andrangs von Verwundeten unter primitiven Verhältnissen nicht tun. Um so mehr bemühte Leo sich um meinen Abtransport. Er erreichte es, dass ich am Dienstag auf den Dampfer „Fritz" verladen wurde, der uns in Richtung Heimat transportierte. Es war eine fürchterliche Fahrt, der Karwoche angemessen.
Wir lagen dichtgedrängt auf Stroh unter freiem Himmel im Laderaum des Schiffs. Die wenigen Sanitätsdienstgrade ließen sich kaum blicken, geschweige, dass sie uns eine Konservenbüchse zur Erledigung unserer Notdurft anreichten. Links und rechts von mir sterbende Kameraden. Meine Wunde nässte intensiv, so dass bald nicht nur der Verband, sondern auch meine Wolldecke durchnässt war. Wir litten Hunger und Durst. Auf der Höhe von Gdingen blieben wir längere Zeit liegen; hier wurde anscheinend ein Geleitzug zusammengestellt.
So war es eine Erlösung, als wir Karsamstag (31. 3.) in Swinemünde ankamen und nach Heringsdorf ins Kriegslazarett geschafft wurden. Auch ohne Gottesdienst kam etwas Osterstimmung in mir auf.
Das Lazarett in Heringsdorf war ein großes Hotel. Wir Verwundeten lagen in der Empfangshalle auf dem Fußboden. Die medizinische Behandlung bestand nur in Tabletten und Notverbänden. Nach einigen Tagen, am 4. April 1945, wurden wir verladen. Das Gerücht, es ginge nach Böhmen, sollte sich, Gott Dank, nicht bewahrheiten. Nach öfterem Hin und Her landeten wir am 7. April in Helmstedt und wurden in das „Reservelazarett II Helmstedt, Abt. Oberschule", eingewiesen. Das Lazarett war eben erst in einem Gymnasium eingerichtet worden.
Alles war provisorisch und primitiv. Kleidung war nicht zu bekommen. Dabei waren ein schmutziges Hemd und eine Decke das einzige, was ich am Leib hatte. Am 12. April überrollten die alliierten Truppen die Stadt, wir waren Kriegsgefangene der Amerikaner. In unseren Betten merkten wir kaum etwas von der „Befreiung". Doch nicht nur wegen des besseren und reichlicheren Essens waren wir glücklich; wir atmeten auf, weil wir trotz Gefangenschaft wieder freie Menschen waren. Die Rede von Goebbels am 20. April, dem Geburtstag des „Führers": „Nie sind wir, dem Siege näher gewesen", erschien uns als teuflische Ironie.
Meine Wunde im linken Oberschenkel wollte nicht heilen, sie hinderte aber auch nicht ernsthaft am Gehen. Außer Rivanol-Umschlägen hatte die ärztliche Betreuung nichts zu bieten. An eine Entfernung des Splitters war in diesem primitiven Notlazarett nicht zu denken. Wir konnten uns in der Stadt Helmstedt ziemlich frei bewegen. So nahm ich Fühlung auf mit dem Pfarrer der katholischen Gemeinde, der mir einige Kleidungsstücke schenkte, so dass ich mich als Zivilist unter die Leute mischen konnte.
Als die Russen bei der endgültigen Festlegung der Zonengrenzen ihr Gebiet weiter nach Westen verlegen konnten, wurde Helmstedt Grenzstadt. Das hatte sich unter den Soldaten der betroffenen Gebiete frühzeitig herumgesprochen. Sie suchten deshalb möglichst nach Westen hin Land zu gewinnen. Es war erschütternd zu beobachten, wie alles, was gehen oder auch nur kriechen konnte, sich dem Einfluss der Russen zu entziehen suchte. Amerikaner, Engländer und Franzosen einigten sich über das jeweils von ihnen besetzte Gebiet im Westen. Niedersachsen wurde den Engländern übertragen. Das bedeutete für uns spürbar schlechtere Verpflegung und, was noch schwerer wog, ein kleinliches Reglement; wir konnten z. B. nicht mehr ohne weiteres das Lazarett verlassen.
Die Eintragung im Krankenblatt lautete unter dem 2. Juni: „Die erbsengroße Granatsplitterverletzung am oberen Ende des hinteren Drittels an der Außenseite des Oberschenkels ist restlos vernarbt. Ebenso die 5 cm lange, 1½ cm breite Narbe über dem linken Rollhügel. Die 25 cm lange Operationsnarbe über dem linken Becken sondert immer noch Sekret ab. Behandlung mit Rivanol. Die Drüsenschwellung in der Leistenbeuge geht auf Behandlung mit feuchten Verbänden zurück."
Heimkehr nach Wettringen – Religionslehrer
Meine Bemühungen, nach Wettringen entlassen bzw. verlegt zu werden, hatten am 28. Juni Erfolg. Die Eintragung im Krankenblatt lautete: „Wird auf Anordnung der englischen Militärregierung in das Heimatlazarett Wettringen bei Rheine in Westfalen verlegt."
Ich begab mich aber zuerst nach Willingen (Waldeck), wo meine Eltern evakuiert waren. Hier erfuhr ich, dass mein Bruder Werner vermisst wurde und von meinem Bruder Leo keine Nachricht vorlag. Die Freude über meine Rückkehr war sicherlich groß. Doch hatte ich den Eindruck, dass meine Mutter damit fast gerechnet hatte und sich ungleich größere Sorgen um meinen Bruder Leo machte, der, wie sich später herausstellte, am 3. Mai in Berlin-Spandau gefallen war. Das „Heimatlazarett" Wettringen war im „Josefshaus" untergebracht. Mein Schlaf- und mein Arbeitszimmer waren vom Lazarett nicht beansprucht. So konnte ich sie beziehen und darin wieder ein ziviles Leben führen. Der Stabsarzt des Lazaretts entfernte den Splitter in der linken Leiste, so dass die immer noch nicht geschlossene Wunde endlich heilen konnte.
Während ich noch das Bett hütete, besuchte mich Wilhelm Schäfers, der geistliche Direktor der „Genossenschaft der Brüder von der christlichen Liebe", der späteren Canisianer. Er war vom Generalvikar Meis geschickt mit der Frage, ob ich nicht die Leitung der Brüdergenossenschaft übernehmen wollte. Ich kannte die Brüder von meiner Tätigkeit im Josefshaus (Wettringen) her, in dem die Brüder wie im Martinistift (Appelhülsen) und in Haus Hall (Gescher) Erziehungs- und Ausbildungsaufgaben wahrnahmen.
Man traute mir zu, dass ich ein unmittelbares Verständnis für die Mentalität der Nachkriegsgeneration hätte und der Brüdergemeinschaft neuen Auftrieb geben könnte. Ich lehnte ab mit der Begründung, ich könne nicht Oberer von Ordensleuten sein, wenn ich deren Verpflichtungen nicht auch selbst übernähme. Wenige Jahre später hat Bischof Michael Keller der „Brüdergemeinschaft der Canisianer" mit dem neuen Namen auch eine andere Struktur gegeben; die Leitung wurde einem der Brüder übertragen.
Nach meiner Genesung machte ich mich im Josefshaus Wettringen noch einige Monate nützlich, indem ich die Leitung einer Gruppe von schulentlassenen Jungen übernahm; diese Arbeit machte mir viel Freude. Mit Datum vom 15. November 1945 wurde ich zum Hausgeistlichen im Kloster zum Hl. Kreuz in Freckenhorst ernannt. Die Schwestern – Franziskanerinnen von der Buße und der christlichen Liebe (Nonnenwerth) – betrieben eine Landfrauenschule, an der ich den Religionsunterricht zu geben hatte. Mit erwachsenen Schülerinnen die Glaubens- und Lebensfragen zu behandeln, war eine dankbare Aufgabe. Im Kreuzkloster war auch ein Teil der in Münster durch Bomben zerstörten Raphaelsklinik – neben der Chirurgie die Frauen- und Kinderstation – untergebracht. Die Krankenhausseelsorge, die ich wahrzunehmen hatte, schloss die Taufe der zahlreichen Neugeborenen ein.
Der Einsatz in der Seelsorge gefiel mir sehr; um so gelassener konnte ich der Zukunft entgegensehen. Ob Wissenschaft oder normale Seelsorge, beides konnte mir recht sein.
Meiner Habilitation stand entgegen, dass Professor Lortz noch nicht „entnazifiziert" war und seine Lehrtätigkeit nicht ausüben durfte. Die Professur hatte Herr Prälat Professor Dr. Georg Schreiber übernommen, der mir als einem Schüler von Lortz nicht besonders gut gesonnen war. In dieser unklaren Situation meinte Generalvikar Meis, ich solle das philologische Staatsexamen machen und zunächst den Weg des geistlichen Studienrates gehen. Das lehnte ich ab mit der Begründung, ich traute mir nicht zu, später als über Fünfzigjähriger noch hauptamtlich vor Kindern zu stehen. Dazu gehöre ein besonderes Charisma, das zu haben ich mir nicht sicher sei. Generalvikar Meis war einverstanden, dass ich unbekümmert um die Situation an der Katholisch-Theologischen Fakultät in Münster auf die Habilitation hinarbeitete. Zunächst hatte ich mich aber in die mir gestellten seelsorglichen Aufgaben einzuarbeiten. Dazu kam die Arbeit mit der studierenden Jugend. Bald meldeten sich die Jungen aus Münster; wir sollten die Jugendarbeit im Stile des Bundes Neudeutschland wieder aufnehmen.
Das war nicht selbstverständlich. Denn inzwischen hatte sich wegen des Verbotes der Jugendverbände im NS-Regime eine anders strukturierte Tugendarbeit entwickelt, die auf dem Boden der Pfarrei alle Jugendlichen erfasste und auf eine berufliche Gliederung verzichtete. Es stellte sich die Frage: War „Pfarrjugend" nur ein Notbehelf angesichts der Naziverfolgung, oder war sie die überhaupt bessere und der Kirche gemäßere Form der Jugendarbeit? Die Diskussion darüber wurde lebhaft, ja leidenschaftlich geführt.
Prälat Wolker und das „Jugendhaus" Düsseldorf waren für die Pfarrjugend; Pater Ludwig Esch SJ trat nach anfänglichem Zögern und auf Drängen der Jungen hin für die berufsmäßig gegliederte Jugendarbeit ein. Wenn letzteres sich durchsetzte, hätte das aber einen engeren Zusammenschluss der Spitzen der eigenständigen Verbände auf Bundes- oder Diözesanebene nicht auszuschließen brauchen. Doch dazu sollte es zunächst nicht kommen, und auch der später entstandene „Bund der katholischen Jugend" entsprach diesem Anliegen nur teilweise. Für die bündische Jugend „Neudeutschland" und „Sturmschar" stellte sich beim Neubeginn dazu die Frage, ob man die bündischen Formen und Gebräuche wie „Kluft", Banner, Liedgut und Fahrten wiederaufleben lassen sollte. Mit einem großen Zeltlager in Vohren bei Warendorf vom 2. 8. bis zum 5. 8. 1946 für die Marken (Diözesen) der englisch besetzten „Zone" machten wir den Versuch. „Wir", d.h. außer mir Hans Haven, der vor allem für die musische Seite verantwortlich war, und Studienrat Dr. Burlage, der dank seiner guten Beziehungen zu den Bauern der Umgegend dafür sorgte, dass die Küche die hungrigen Mäuler stopfen konnte.
Das Zeltlager mit der Thematik: „Zurück zum Menschen – Zurück zur Gemeinschaft – Zurück zum Christen: Erbe und Aufgabe", wurde ein großer Erfolg. Niemand hatte den Eindruck, dass hier den Jungen Unzeitgemäßes aufgepfropft wurde. Ähnliches galt von den „Führerschulen" und dem großen Zeltlager, das im Jahre 1947 wiederum in Vohren abgehalten wurde.
Rom – Campo Santo Teutonico
Inzwischen hatte sich meine Situation entscheidend geändert. Hubert Jedin in Rom verfügte über eine beträchtliche Summe Schweizer Franken, die er stiftungsgemäß dafür verwandte, jüngeren Deutschen einen Studienaufenthalt in Rom zu ermöglichen. Vor mir hatte August Franzen ein solches Stipendium bekommen, nach mir bekamen es Eduard Stommel, Alfred Stuiber und Bernhard Kötting. Jedin wandte sich an Lortz mit der Frage, ob er nicht einen jungen Mann vorschlagen könne. Die Wahl fiel auf mich. Am 18. 4. 1947 schrieb Jedin: „Lieber Lortz. Ihren Schüler Iserloh müssen wir in den Campo Santo bringen. Mein Vorschlag ist, dass er sich durch das Ordinariat Münster beim Rektor des Campo Santo, Mons. Stoeckle, für den November anmeldet, mit dem Bemerken, dass er keine Freistelle beansprucht, sondern als zahlender Konviktorist eintritt. Ich werde dafür sorgen, dass er, zunächst einmal für ein Jahr, in Rom die entsprechenden Mittel erhält. Nur bitte ich, dass mein Name nicht genannt wird ..."
Mir schrieb Jedin am 28. 7. 1947: „... Durch eine beiläufige Bemerkung unseres Rektors erfuhr ich, dass der Kapitelsvikar Sie bereits angemeldet hat. Es wäre gut, wenn der neue Bischof in irgendeiner Form zum Ausdruck brächte, dass er mit Ihrem Studienaufenthalt hier einverstanden ist ... Kommen Sie also! ... Kein Satz in Ihrem Brief hat mich mehr gefreut als der: Ich komme nach Rom, um zu lernen. Lernen und arbeiten –das können Sie hier in reichem Maße. Sie werden in unserem Hause Gleichgesinnte finden: Dr. Hoberg aus Osnabrück, Dr. Franzen aus Köln, vielleicht auch noch einen anderen Kölner. Haben Sie schon ein Arbeitsprogramm? Es ist gut, sich schon vorher einige Möglichkeiten zu überdenken; wenn Sie dann hier sind, können wir noch darüber sprechen ... Also auf Wiedersehen in Rom! Ihr H. Jedin."
Abgesehen davon, dass jeder Kirchenhistoriker Rom und Italien näher kennengelernt haben sollte, war für mich das Angebot von Jedin eine große Chance. Im Deutschland des Aufbaus nach 1946 hätte ich mich allzuleicht verzettelt. Bei der Besorgung der notwendigen Reisepapiere – Ausreise aus Deutschland, Durchreise durch Italien und Einreise in die Citt del Vaticano – waren Pater Ivo Zeiger SJ und der Bischof Aloys Joseph Muench behilflich. Dieser, Bischof von Fargo (ND), war seit 1946 Apostolischer Visitator für die Katholische Kirche Deutschlands und hatte seinen Sitz in Kronberg im Taunus, wo ich ihn aufsuchte. Mit dem Pass hatte ich aber noch kein Geld für die Fahrt durch die Schweiz und Italien. Mit einer Fahrkarte bis Basel machte ich mich Mitte November bei nebeligem Wetter auf den Weg. Doch als ich in Basel den Nachtzug verließ, schien die Sonne. Ich suchte die nächste katholische Kirche bzw. das nächste Pfarramt auf und ließ mir von dem Pfarrer, der Verständnis für meine Lage hatte, einige Messstipendien geben. Diese ermöglichten den ungewohnten Genuss eines Frühstücks mit Weißbrot, „guter Butter" und Bohnenkaffee und den Kauf einer Fahrkarte nach Luzern, wo ich mir vom dortigen Caritasverband Geld für die Fahrt nach Rom geben ließ.
Im „Campo Santo" rechnete man mit meinem Kommen. Der Empfang durch Hubert Jedin war besonders herzlich. Er hatte meinen Aufenthalt ja möglich gemacht – allerdings ohne dass der Rektor von seiner Aktivität erfuhr. Bald wurde mir klar, dass der „Allvater", wie wir Jedin nannten, die eigentliche Seele des Hauses war. Manchen Abend fanden wir wenigen Deutschen uns mit den Trentinern und Schweizern auf seinem Zimmer zu einem Glas Wein zusammen. Das Abendessen war erst um 20 Uhr. Damit war der eigentliche Arbeitstag durchweg zu Ende, und es blieb Zeit für nützliche und erholsame Gespräche.
Was meine Arbeit in der Vatikanischen Bibliothek anging, so waren meine Vorstellungen zunächst recht vage. Ich hatte die Absicht, die Theologie des Spätmittelalters, speziell des Nominalismus, zu studieren, über welche Lortz die These vertrat, dass sie nicht „vollkatholisch" war.
Meine Studien über den „Kampf um die Messe" hatten zu dem Ergebnis geführt, dass für Luther, der hier im Banne der nominalistischen Philosophie stand, Gedächtnis eine bloße Gegebenheit im Bewusstsein des Menschen ist und nicht an der Wirklichkeit partizipiert: deshalb konnte in seiner Sicht das Gedächtnis des Opfers am Kreuz als solches noch kein Opfer sein: „Wie seid ihr denn so kühn, dass ihr aus dem Gedächtnis ein Opfer macht?" (WA 8, 421). Musste aber zum Gedächtnis ein eigener Opferakt hinzukommen, dann waren die Einmaligkeit und das volle Genügen des Kreuzesopfers in Frage gestellt und hatte Luther Grund, die Messe als Opfer schärfstens zu bekämpfen. Die katholischen Gegner Luthers waren um nichts weniger der nominalistischen Denkweise verhaftet, so dass ihnen der Weg versperrt war, den Opfercharakter der Messe damit zu begründen, dass sie memoria und repraesentatio des Kreuzesopfers ist.
Weil das Andenken an ein Ereignis oder seine bildliche Darstellung nicht das Ereignis selber ist bzw. nicht an seiner Wirklichkeit partizipiert, ist die Messe als memoria noch kein Opfer; es muss zum Bildmoment noch das Sachmoment hinzukommen. Deshalb argumentiert z.B. Johannes Eck: Ja, die Messe ist memoria und als solche kein Opfer; aber hinzukommt noch die Darbringung des realgegenwärtigen Christus, und deshalb ist sie ein wahres Opfer. Das einmalige blutige Opfer am Kreuze schließt – so meint Eck – ein „anderes", unblutiges Opfer, in dem Christus sich nach der Weise des Melchisedek, d.h. unter Brot und Wein, opfert, nicht aus. Diese Antwort konnte Luther nicht zufriedenstellen; weil die Einmaligkeit des neutestamentlichen Opfers nicht gesichert war. Die Identität der Opfergabe reichte dazu nicht aus.
Wieweit dieses Versagen der Theologie zu Beginn der Reformation auf einem Defizit der spätmittelalterlichen Theologie beruhte, damit befassten sich meine Studien. Ganz von selbst ergab sich eine Konzentration auf den englischen Franziskaner Wilhelm von Ockham († 1347), speziell auf seine Gnaden- und Eucharistielehre. Ich befasste mich nicht mit seiner großen Bedeutung für die Logik, die gar nicht strittig war. Wohl schien es mir von Bedeutung, dass die Logik bei Ockham einen so breiten Raum einnimmt und die Seinsphilosophie stark in den Hintergrund tritt. Von einer Theologie des Messopfers kann bei Ockham und den Theologen des 14. und 15. Jahrhunderts nicht die Rede sein. Ihr Interesse gilt einseitig der Realpräsenz von Leib und Blut Christi aufgrund der Transsubstantiation und in Verbindung damit naturphilosophischen Fragen, etwa dem Verhältnis von Substanz und Quantität; z.B. wie kann bei einer ausgedehnten Substanz wie dem Brot die Substanz verschwinden und die Ausdehnung bleiben? Die Beschäftigung mit diesen zum Teil recht abstrusen Gedankengängen, die dazu auf schwer lesbaren Manuskripten des 14. Jahrhunderts überliefert sind, war keine reine Freude.
Zum Glück bestand für mich Rom ja nicht allein darin. Ich war nicht willens, bei den spätmittelalterlichen Codices meine ganze Zeit zu verbringen, sondern bemühte mich, mit dem Rom vertraut zu werden, das Ockham und die Spätscholastik mir nicht vermitteln konnten: das Rom der Katakomben und der Kirchen und Paläste, aber auch das Rom, das sich in den großen Gottesdiensten, in Papstaudienzen und Heiligsprechungen lebendig darstellte. Dazu diente u.a. die Immatrikulation beim Päpstlichen Archäologischen Institut. Hier hörte ich patristische Vorlesungen bei Erik Peterson und archäologische bei E. Josi und A. Ferrua. Wichtiger als die Vorlesungen waren mir die Führungen, die Prof. Josi an den Mittwochnachmittagen abhielt, zu denen die Schüler des Istituto Archeologico Zugang hatten. So habe ich im Laufe der drei Jahre die wichtigsten, sonst nicht zugänglichen Katakomben und andere christliche wie heidnische Monumente kennengelernt.
Hatte bisher das Schwergewicht meiner kirchengeschichtlichen Studien einseitig auf dem Mittelalter und der Neuzeit gelegen, so begegnete ich in Rom auch der alten Kirche, und zwar weniger durch Bücherstudium als durch unmittelbare Berührung mit den Monumenten.
Zu kostspieligen Reisen fehlte das Geld. Dennoch ergaben sich manche Möglichkeiten, Italien kennenzulernen. Nach Apulien und Sizilien führten mich Aufträge der Pontificia Commissione di Assistenza, der internationalen Caritas, in der Carlo Bayer die Betreuung der Deutschen wahrnahm. Ostern und Pfingsten 1948 bekam ich den Auftrag, die Insel Lipari, die größere der Äolischen Inseln an der Nordseite Siziliens, aufzusuchen. Hier hatten unter Mussolini politische Gefangene ihre Festungshaft abgesessen.
Nach Kriegsende waren hier Deutsche interniert, die keine ordnungsgemäßen Papiere hatten oder straffällig geworden waren. Ich hatte den Auftrag, an den Festtagen für diese Internierten Gottesdienst zu halten. Der Zugang zu diesen Männern war erleichtert durch zwei große Koffer mit Wäsche und Kleidung, die man mir aus dem Magazin von Schwester Pasqualina, der Haushälterin Pius XII., mitgegeben hatte. Wollte ich die Abendstunden zu seelsorglichen Gesprächen nutzen, dann musste ich mich nach dem Reglement mit den Internierten in deren Quartieren einschließen lassen. Diese Solidarität mit den Gefangenen wurde entgolten durch gesteigertes Vertrauen. Es gab vieles zu besprechen, und sicher nicht nur über das Wetter.
In den Sommerferien 1948 und 1949 habe ich in Cattolica an der Adria deutsche Kinder betreut, die hier auf Einladung des päpstlichen Hilfswerks, der Pontificia Commissione di Assistenza, zusammen mit Kindern aus Italien, der Schweiz und Österreich ihre Ferien verbrachten. So lernte ich auch ohne Geld größere Teile Italiens kennen.
Bis zur Währungsreform standen uns keine Barmittel zur Verfügung, außer Messstipendien in Höhe von 110 Lire, dem Sechstel eines Dollars, die der Rektor des Campo Santo für uns beim Staatssekretariat beantragen musste. Eine solche Domanda aufzusetzen, war für ihn eine wahre Staatsaktion, und es bedurfte wiederholter Bitten, bis er sich dazu bequemte.
Eine andere Geldquelle bedurfte nicht umständlicher Formalitäten, war dafür aber um so fragwürdiger: Der Campo Santo lag praktisch innerhalb der Città del Vaticano und konnte wie die anderen Institute und Haushalte die Lebens- und Genussmittel zu erheblich günstigeren Preisen aus der Kantine des Vatikans beziehen. Dazu gehörte auch ein Kontingent amerikanischer Zigaretten. Für uns Nichtraucher waren sie so viel wert wie bares Geld. Dino, der Pförtner des Hauses, verkaufte sie in der Stadt zu einem mehr als doppelten Preis.
Hatten die Vatikanische Bibliothek und das Archiv nur am Vormittag geöffnet, dann kam es uns zustatten, dass wir nachmittags in der Bibliothek des Hauses arbeiten konnten. Allerdings wies diese große Lücken auf. Es hatte ja schon längere Zeit an dem nötigen Geld gefehlt, die wichtigsten Bücher anzuschaffen und die Zeitschriften und wissenschaftlichen Reihen zu ergänzen.
Das wurde etwas anders mit dem Heiligen Jahr 1950. Anlässlich der Führung von Pilgergruppen konnten wir Pilger zu Stiftungen für den Campo Santo und seine Bibliothek motivieren. Damit wurden wichtige Anschaffungen für die Bibliothek möglich; darunter war z.B. die Wiener Ausgabe der lateinischen christlichen Schriftsteller (CSEL). Dank der Initiative von Pater Engelbert Kirschbaum, dem Direktor des Römischen Instituts der Görres-Gesellschaft, konnte auch der Vortragssaal im Erdgeschoss hergerichtet werden. Das Römische Institut der Görres-Gesellschaft war das einzige unter den deutschen, das seine Arbeit schon bald nach Kriegsende aufnehmen konnte. Damit waren günstige Startbedingungen für die öffentlichen Vorträge gegeben, die wir neben den hausinternen „Sabbatinen" hielten und zu denen sich ein verhältnismäßig großer Kreis von deutschsprachigen Römern einfand.
Repetent in Münster – Habilitation in Bonn
Das Heilige Jahr 1950 habe ich nicht bis zum Ende in Rom verbracht. Meine Habilitationsschrift wär fertig, und ich wollte mich zum schnellstmöglichen Termin zur Habilitation melden. Mit Bischof Michael Keller hatte ich schon im Mai 1950 ausgemacht, dass ich im Collegium Borromaeum Wohnung nehmen und bei der „Theologenerziehung" helfen sollte. Der Bischof plante, eine größere Zahl von jungen Priestern, Doktoranden und Mitarbeitern in der überpfarrlichen Seelsorge, im Borromaeum wohnen zu lassen; sie sollten mit den Theologen in Vita Communis leben. Diese wiederum sollten im alltäglichen Umgang Einblick in das Leben und Wirken junger Priester verschiedener Veranlagung und Tätigkeit gewinnen und so lebendig und realistisch für ihren Priesterberuf motiviert werden.
Als ich am 1. Dezember nach Münster kam, rechnete der Direktor des Borromaeums schon nicht mehr mit mir. Inzwischen hatte man sich an verschiedenen Stellen über meinen weiteren Lebenslauf Gedanken gemacht. Ich sollte mich in Bonn habilitieren. Damit würde die „Hausberufung" als Argument gegen mich bei der Nachfolge von Professor Schreiber wegfallen. Professor Jedin in Bonn war gerne bereit, mich zu habilitieren, meinte aber, dann dürfte ich nicht in Münster in der Theologenausbildung stehen. Er hatte deshalb Bischof Michael vorgeschlagen, mir eine Stelle im rheinischen Teil der Diözese zuzuweisen. Mir ging es im Augenblick vor allem darum, irgendwo zur Ruhe zu kommen, und so bat ich den Bischof um sein Einverständnis, zunächst im Borromaeum Wohnung nehmen zu dürfen. Der Bischof schrieb mir am 4. 12.: „Herzlich willkommen. Selbstverständlich freue ich mich sehr, wenn Sie im Borromaeum Wohnung nehmen und uns bei der Theologenerziehung helfen. Aus einer Äußerung des Herrn Dekan glaube ich, entnehmen zu müssen, dass von Ihrer Seite aus keine Möglichkeit mehr dazu bestände. – Um so besser ..."
Das Ergebnis des Hin und Her war: Ich wurde beauftragt, den versetzten Kaplan von Cappenberg bei Lünen zu ersetzen und dort an den Sonn- und Feiertagen die Aushilfe in der Seelsorge zu leisten. Während der Woche sollte ich als Repetent im Borromaeum in Münster tätig sein. In Cappenberg war ich polizeilich gemeldet. Damit waren auch die Erwartungen der Bonner Fakultät erfüllt. Unter der Anschrift Cappenberg, Pfarrhaus, stellte ich am 15. Januar den Antrag auf Zulassung zur Habilitation und Erteilung der „Venia legendi" für Kirchengeschichte und für Dogmengeschichte des Mittelalters und der Reformationszeit. Gleichzeitig sollte August Franzen habilitiert werden. Als Einheimischer sollte er aber den Vortritt haben. Da die Gutachter seiner Habilitationsschrift sich länger Zeit nahmen, verzögerte sich der Termin für die Probevorlesungen bis zum 7. Juli. Am 10. Juli 1951 teilte mir Jedin als Dekan mit: „Ihre Probevorlesung: ‚Grundzüge der Frömmigkeit und der Glaubensverkündigung des heiligen Bonifatius' und das anschließende Colloquium sind zur Zufriedenheit der Fakultät ausgefallen. Im Einverständnis mit Sr. Eminenz dem Herrn Erzbischof von Köln wird Ihnen hiermit gemäß dem in der Fakultätssitzung vom 7. Juli 1951 gefassten Beschluss die ‚Venia legendi' für das Fach der Kirchengeschichte erteilt."
Die Verzögerung wirkte sich für mich sehr nachteilig aus. Denn inzwischen war Professor Schreiber zu seiner und der Fakultät großer Überraschung zum 1. April emeritiert worden. Die Fakultät hatte mit einer jahrelangen Verlängerung seines Lehrauftrags gerechnet, wie es bei Hochschullehrern, die aus politischen Gründen von der NS-Regierung aus dem Amt entfernt worden waren, eigentlich üblich war. Zur Aufstellung der Nachfolgeliste ließ man sich nicht viel Zeit. In der ersten Fakultätssitzung am 2. Mai wurde die Liste erstellt.
Obwohl der Fakultät in Münster von Bonn mitgeteilt wurde, meiner Habilitation stünden nur noch Verfahrensfragen im Wege, sie werde sicherlich im Laufe des Sommers erfolgen, wurde mir ein Platz auf der Berufungsliste verweigert mit der Begründung, ich sei noch nicht habilitiert.
Die Liste lautete: Professor Josef Oswald (Passau), Professor Eduard Hegel (Trier), und Dr. Wolfgang Müller (Freiburg). Letzterer wurde – wie ich – auch erst im Jahre 1951 habilitiert. Professor Oswald bekam den Ruf, nahm sich aber sehr viel Zeit für die Zu- bzw. Absage. So wurde ich doch für zwei Semester (WS 1952/53; SS 1953) mit der Vertretung der Professur in Münster beauftragt, die man mir verweigert hatte.
Direktor des Franz-Hitze-Hauses
Überraschend kam in diese Tätigkeit hinein die Bitte meines Bischofs, die Leitung des Franz-Hitze-Hauses, der Sozialen Bildungsstätte der Diözese, zu übernehmen, die eben erst ihre Arbeit aufgenommen hatte. Wieder einmal sollte ich erfahren, wie vielerlei Fähigkeiten die Kirche von ihren Priestern erwartet. Am 30. März 1953 wurde ich zum Direktor der Sozialen Bildungsstätte „Franz-Hitze-Haus" in Münster, zum Mitglied des Kuratoriums dieses Hauses und zum Geistlichen Beirat der Sozialen Seminare im Bistum Münster ernannt. Diese Tätigkeit war von vornherein nur für ein Jahr gedacht; es galt, eine Verlegenheit zu überbrücken. Für das SS 1954 konnte ich mit einer Berufung nach Trier rechnen, von wo Eduard Hegel einem Ruf nach Münster gefolgt war. Wenn auch nur vorübergehend, so stellte die Aufgabe als Sozialreferent der Diözese und als Direktor eines Hauses, das noch kein Gesicht hatte, hohe Anforderungen. In diese Zeit fiel z. B. ein langwieriger und mit Erbitterung geführter Streik der Textilarbeiter des Münsterlandes.
Neben den Sozialen Seminaren, die an verschiedenen Orten der Diözese durchgeführt wurden, und Arbeitstagungen für Betriebsangehörige des Bergbaus mit dem Thema „Der Mensch im Betrieb" hielten wir im Franz-Hitze-Haus mit Erfolg Wochenenden für die Primaner der Gymnasien ab.
Wir gingen davon aus, dass die ersten Semester an der Universität für etwas anderes als ihr Fachstudium keine Zeit haben würden. Wollten wir junge Akademiker mit der Soziallehre der Kirche vertraut machen, dann mussten wir sie schon als Unterprimaner einladen. Die Entwicklung gab uns Recht. In den folgenden Jahren sollten die Kurse für Primaner nicht mehr aus den Veranstaltungskalendern des Franz-Hitze-Hauses, aber auch der Kommende in Dortmund und der Akademie in Trier, verschwinden.
Professor der Kirchengeschichte in Trier
Am 10. Februar 1954 berief mich der Bischof von Trier als Kanzler der Theologischen Fakultät zum außerordentlichen Professor der Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit. Münster hatte damals den Ruf der Fortschrittlichkeit, u.a. galt auch ich als „modern". Jedenfalls war das erste, was mir Bischof Matthias Wehr bei meinem Antrittsbesuch ans Herz legte, ich solle nicht meinen, dass in Trier alles so fortschrittlich vonstatten gehe wie in Münster. Bei anderer Gelegenheit machte er mich mit einem Bescheid aus Rom – wahrscheinlich die Antwort auf die Einholung des „placet" – bekannt, ich solle mich einer weniger kritischen Art befleißigen.
Die Mehrzahl der Professoren, die für die Studenten des 1. bis 4. Semesters Vorlesung hielten, wohnten mit diesen im Rudolfinum, wo auch die Vorlesungen stattfanden. Diese „vita communis" von Professoren und Studenten förderte den gegenseitigen Kontakt, der allerdings von der Seminarleitung nicht ohne Bedenken beobachtet wurde. Es lag nahe, dass gerade Studenten, die Schwierigkeiten bezüglich ihres Berufs hatten oder sich mit der Hausleitung rieben, das Gespräch mit einem Professor suchten und nach den Mahlzeiten den Rundgang ums Haus nutzten, um ihre Schwierigkeiten zu besprechen. Mancher Student stand faktisch schon außerhalb des Seminars, ihn konnte und durfte man nicht halten; es galt aber, ihm zu helfen, ohne Ressentiments auszuscheiden.
Ich hatte eben – wie ich meine mit Erfolg – mein erstes Semester hinter mich gebracht, als schon wieder eine Entscheidung über Ort und Art meiner Tätigkeit gefordert wurde. Bischof Westkamm hatte vom Senat der Stadt Berlin erreicht, dass an der Freien Universität Berlin eine Professur für Katholische Weltanschauung eingerichtet wurde als Fortsetzung des Lehrauftrags, den Romano Guardini bis zu seiner Absetzung durch das NS-Regime wahrgenommen hatte. Die Vorlesungen sollten schon im SS 1955 beginnen. Was ich bereits inoffiziell von Hubert Jedin erfahren hatte, wurde mir am 9. September 1954 durch Johannes Pinsk mitgeteilt, der vom Bischof beauftragt war, mit dafür geeigneten Professoren in die entsprechenden Verhandlungen einzutreten. Er fragte bei mir an, ob ich bereit sei, einen an mich ergehenden Ruf anzunehmen. „Sie sind zwar in erster Linie Kirchenhistoriker, aber ich glaube, dass Sie auch mit der Problematik der übrigen theologischen Disziplinen so vertraut sind, dass Sie über Ihr engeres Fachgebiet hinaus die Studenten allgemein theologisch und religiös anzusprechen imstande sind. Das müsste natürlich unbedingt geschehen. Sie würden natürlich als katholischer Theologe auch innerhalb der Fakultät vielfach um Stellungnahme zu anderen wissenschaftlichen Problemen von der christlichen Theologie her angegangen werden."
Jedin sah in Berlin eine wichtige und interessante Aufgabe für mich, andererseits bedauerte er, dass ich dadurch der Kirchengeschichte entfremdet würde. Wie er mir schrieb, würde in Berlin der Rahmen meiner amtlichen Tätigkeit viel weiter gespannt sein. „Aber Du stehst in Berlin auf einem der vorgeschobensten Posten, die es überhaupt für einen katholischen Theologen gibt. Reizt Dich diese Aufgabe nicht?" Sie reizte mich schon. Die Frage war für mich nur, ob ich den Anforderungen gewachsen war. An sich war vor allem daran gedacht, mit der Einrichtung dieser Professur, die durch Lehraufträge ergänzt werden sollte, Studierenden die Möglichkeit zu geben, die Facultas für Religion an weiterführenden Schulen zu erwerben. Faktisch war aber der Erwartungshorizont viel weiter gespannt. Für eine breitere Öffentlichkeit ging es um die Nachfolge Romano Guardinis. Damit ich mich überfordert.
In meiner Absage, auf die ich Johannes Pinsk nicht lange warten ließ, habe ich davon aber nichts bemerkt, sondern neben familiären Rücksichten als Grund angegeben: „Die Aufgabe in Berlin würde mich von der Kirchengeschichte, von meinen wissenschaftlichen Plänen und vielleicht von der Wissenschaft überhaupt wegführen. Ich will nicht sagen, dass das alles wichtiger ist als die in Berlin zu leistende Arbeit; aber ich habe das Gefühl, dass ich diese andere ebensogut, wahrscheinlich sogar besser machen werde."
Die Professur erhielt der Luxemburger Marcel Reding, der gerade eine Studie über Marxismus und Christentum herausgegeben hatte, was ihn vielleicht für Berlin besonders empfohlen hatte. Meine Option für Trier honorierte die Fakultät durch meine Ernennung zum Ordentlichen Professor am 31. März 1955.
Ausstellung des Heiligen Rockes
Zu einem Loyalitätskonflikt kam es 1959 anlässlich der Ausstellung des Heiligen Rockes. Zwangsläufig stellte sich die Frage nach der Echtheit dieser Reliquie. Von mir als dem Professor für Kirchengeschichte des Mittelalters wurde eine klärende Stellungnahme erwartet. Ich glaube aus den Quellen zweifelsfrei bewiesen zu haben, dass die in Trier verehrte Tuchreliquie nicht materiell identisch ist mit der Tunica Christi, dass es sich vielmehr um eine Berührungsreliquie handelt. Nicht weniger wichtig war mir aber zu zeigen, dass damit der Wallfahrt nach Trier nicht die Grundlage genommen ist. Der Heilige Rock ist wie das Kreuz in der Karfreitagsliturgie oder in unseren Kirchen und Wohnungen weniger unter dem Gesichtspunkt der Reliquie als dem eines Bildes zu betrachten. Wie wir ein Kreuz verehren, obwohl wir wissen, dass es nicht das „echte" Kreuz von Golgotha ist, so steht auch der Verehrung des Heiligen Rockes bei bewiesener „Unechtheit" nichts im Wege. Diese These habe ich während der Wallfahrt in der Zeitschrift „Geist und Leben" öffentlich vertreten.
Dem Bischof Wehr war das sicher nicht recht. Als nüchterner Mann hatte er für Bild und Symbol keinen Sinn, und als Kanonist hätte er nach Can. 1284 eine sicher unechte Reliquie entfernen müssen. So ließ er die Frage lieber in der Schwebe. Solange auch ernstzunehmende Gutachter für die Echtheit eintraten, konnte es bei der traditionellen Praxis bleiben. Der Wallfahrtsleiter Domkapitular Dr. Paulus ließ sich zwar Artikel schreiben, die die Echtheit zu beweisen suchten, zeigte aber unter vier Augen Verständnis für meine Auffassung. Er sicherte mir zu, möglichst bald nach der Wallfahrt den Heiligen Rock einer wissenschaftlichen Untersuchung zu unterziehen und ihn in Zukunft in einer Seitenkapelle aufzubewahren, evtl. wie in der Barockzeit in einem silbernen Etui als „redendes Reliquiar". In der Fastenzeit solle man ihn ausstellen. Die Leute sollten wenigstens wissen, wo die Reliquie sich befindet. Es hat einige Jahre gedauert, bis mein Vorschlag im Zusammenhang mit der Domrenovierung zur Ausführung kam. Mir kam es darauf an, kritischen Christen, vor allem Lehrern und Priestern, die von Berufs wegen die Wallfahrt mitmachen mussten, zu ermöglichen, es mit gutem Gewissen und ohne Augurenlächeln zu tun.
Noch Jahre später, im Oktober 1966, als wir uns zum Antritt der von der Katholischen Akademie in Bayern veranstalteten Studien- und Vortragsreise in die USA auf dem Frankfurter Flugplatz trafen, war das erste Wort, das Julius Kardinal Döpfner an mich richtete, ein Wort des Dankes: Ich hätte es ihm durch meine Deutung des Heiligen Rockes ermöglicht, die Wallfahrt guten Gewissens mitzumachen und seine Diözesanen dazu einzuladen.
Thesenanschlag: Tatsache oder Legende?
Einen erheblichen Wirbel habe ich seit 1961 in der Lutherforschung hervorgerufen durch meine These, dass der Thesenanschlag Luthers am 31. Oktober 1517 nicht stattgefunden hat, sondern in den Bereich der Legende zu verweisen ist. Anlässlich einer Rezension des Buches von Hans Volz „Martin Luthers Thesenanschlag und dessen Vorgeschichte" (Weimar 1959), in dem er die These vertrat, Luther habe die Thesen nicht am 31. Oktober, sondern am 1. November angeschlagen, habe ich die Quellen von neuem durchgearbeitet. Dabei fiel mir auf, dass Luther selbst mehrfach, und zwar unmittelbar nach der Veröffentlichung der Thesen wie gegen Ende seines Lebens, beteuert, er habe – bevor einer seiner besten Freunde von seiner Disputationsabsicht erfahren hätte – die Thesen den zuständigen Bischöfen, seinem Ordinarius Bischof Hieronymus Schulz von Brandenburg und dem päpstlichen Ablasskommissar Erzbischof Albrecht von Brandenburg-Mainz, geschickt, mit der Bitte, andere Weisung an die Ablassprediger zu geben und die Lehre vom Ablass durch die Theologen klären zu lassen. Erst als die Bischöfe nicht geantwortet hätten, habe er die Thesen an gelehrte Männer weitergegeben. Der Brief an Erzbischof Albrecht ist erhalten und trägt das Datum „Vigil von Allerheiligen", d.h. 31. Oktober. Hätte Luther an diesem Tag seine Thesen an der Schlosskirche zu Wittenberg angeschlagen, dann hätte er den Bischöfen keine Zeit gelassen zu antworten, was er aber wiederholt beteuert. Er hätte unmittelbar nach dem Ereignis den Papst wie auch seinen Landesherren Friedrich den Weisen belogen und hätte bis zum Ende seines Lebens dieses gefälschte Bild von den Ereignissen aufrechterhalten. Hat aber die „Szene" nicht stattgefunden, wird noch deutlicher, dass Luther nicht in Verwegenheit auf einen Bruch mit der Kirche hingesteuert ist, sondern eher absichtslos zum Reformator wurde. Allerdings trifft dann die zuständigen Bischöfe noch größere Verantwortung. Denn dann hat Luther den Bischöfen Zeit gelassen, religiös-seelsorglich zu reagieren.
Anlässlich einer Diskussion mit Hans Volz, zu der die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Göttingen eingeladen hatte, bemerkte der das Gespräch leitende Kollege in seinem Schlusswort, es sei doch sehr bemerkenswert, dass der katholische Redner für die Ehrlichkeit Luthers eingetreten sei, während der evangelische Partner so leichthin eine Lüge Luthers in Kauf genommen habe. Als die evangelischen Kirchenhistoriker zögerten, sich auf ein ernsthaftes Gespräch über den Thesenanschlag einzulassen, veranstaltete der Historikerverband auf dem Historikertag in Berlin im Oktober 1964 eine Podiumsdiskussion unter Leitung von Hubert Jedin. Meine Gesprächspartner waren Kurt Aland und Hans Volz. Ihre Argumentation war wenig überzeugend. Am Abend auf dem Empfang im Charlottenburger Schloß war das Urteil von Hermann Heimpel: „Es ist zum katholisch werden!" Es ist erstaunlich, wie wenig ernstzunehmende evangelische Lutherforscher bereit waren und sind, auf dieses Stück Folklore des hammerschwingenden Luther zu verzichten.
Aufs Ganze gesehen profitierte meine Generation, mit mir vor allem Peter Manns und Otto Hermann Pesch, von der Wandlung des Lutherbildes, die vor allem Joseph Lortz und Hubert Jedin herbeigeführt hatten. Die katholische Lutherforschung wurde ernstgenommen. Das wurde z.B. deutlich auf dem Dritten Internationalen Kongress für Lutherforschung in Järvenpää/Finnland im August 1966, zu dem zum ersten Male Katholiken eingeladen worden waren und wo ich ein Referat über „Luther und die Mystik" halten durfte.
Auf dem vierten Kongress für Lutherforschung im August 1971 in Saint Louis, Missouri, wurde mir mit Jaroslav Jan Pelikan, Heiko Oberman, Gerhard Ebeling, Chitose Kishi und Bengt Hägglund der Doctor honoris causa verliehen. In seiner Laudatio bediente sich der Dekan zur allgemeinen Erheiterung des Wortspiels: „... whether or not the theses have been nailed (angenagelt) or mailed (mit der Post geschickt) ..."
Seit dem Wintersemester 1961/62 hatte ich zusätzlich einen Lehrauftrag an der Universität Saarbrücken. Einen solchen nahmen einige Trierer Kollegen wahr, um den Studierenden der philosophischen Fakultät die Möglichkeit zu geben, die Lehrbefähigung in Theologie zu erwerben. An einem Nachmittag der Woche fuhr ich nach Saarbrücken, um ein dreistündiges Programm durchzuführen: zwei Stunden Vorlesung und eine Stunde Seminar. Das war sehr anstrengend, aber auch sehr anregend, weil man sich auf eine andere Mentalität einzustellen hatte.
Berufung nach Münster
So wohl ich mich auch in Trier fühlte, ich dachte doch daran, gelegentlich an eine Universität, am liebsten nach Münster, überzuwechseln. Die erste Gelegenheit ergab sich 1962 mit der Einrichtung eines Lehrstuhls für Ökumenische Theologie an der Münsteraner Fakultät. Januar/Februar 1963 stellte die Fakultät eine Vorschlagsliste auf mit den Namen Heinrich Fries (München), Erwin Iserloh (Trier), und Eduard Stakemeier (Paderborn). Da man trotz gegenteiliger Zusicherungen damit rechnen konnte, dass Fries den Ruf ablehnen würde, stand die Sache günstig für mich. Fries hielt die Fakultät über Gebühr lange hin. Die Zeit arbeitete aber nicht für mich. Im Gegenteil: je mehr man nicht mehr mit einer Zusage von Fries rechnete, um so aktiver wurden die Kräfte, die sich meiner Berufung widersetzten. Juli 1963 beschloss die Fakultät, den Kultusminister zu bitten, nach einer eventuellen Absage von Professor Fries die Vorschlagsliste für die Besetzung des Lehrstuhls für Ökumenische Theologie zu sistieren. Im Dezember 1963 hörte man aus der Berufungskommission, dass starke Kräfte für eine Besetzung mit einem Systematiker eintraten. Genannt wurden R. Marlé (Paris) und H. Vorgrimler (Freiburg). Im Januar 1964 blieb die Liste noch offen. Nach der Information seitens der Berufungskommission sollten Vorgrimler und Kasper in engere Wahl gezogen werden. Gleichzeitig wurden allerlei Gerüchte verbreitet, so z.B. ich sei an einer Berufung nach Münster nicht mehr interessiert, weil ich demnächst nach Bochum berufen würde oder als Nachfolger von Lortz in Mainz vorgesehen sei. Andererseits wurde mir die Eignung abgesprochen: Ich sei für einen Ökumenischen Lehrstuhl nicht irenisch genug. All dem setzte der Kultusminister Paul Mikat ein Ende, indem er der Vorschlagsliste folgte und mich als den Zweiten am 25. 2. 1964 berief. Die Ernennung erfolgte nach den üblichen Verhandlungen, in denen ich eine günstige personelle und finanzielle Ausstattung des Instituts erreichte, am 18. Mai zum 1. Juli 1964.
Meine Antrittsvorlesung hielt ich am 24. November 1964 über das Thema: „Das tridentinische Dekret über das Messopfer vor dem Hintergrund der konfessionellen Auseinandersetzung des 16. Jahrhunderts". Die Arbeit im Institut lief gut an. Das erste größere Projekt war eine Untersuchung über das Bild von Protestanten und Juden in den katholischen Schulbüchern. Neben den üblichen Vorlesungs- und Seminarveranstaltungen hielten wir jeden Monat einen – sehr gut besuchten – Vortragsabend mit anschließendem Gespräch für die Professoren beider Theologischen Fakultäten. Als Referenten wurden u.a. Joseph Lortz und Karl Rahner gewonnen. Im Juni 1966 erhielt ich von Theobald Freudenberger die Mitteilung, dass die Katholisch-Theologische Fakultät in Würzburg mich einstimmig auf den ersten Platz der Berufungsliste für die Nachfolge Georg Pfeilschifters gesetzt habe. Er bat mich dringend, dem Rufe zu folgen. Ich hatte ihm schon vorher freimütig gestanden, dass ich die Professur für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit in Münster vorzöge, wenn mir diese angeboten würde. Inzwischen war Eduard Hegel zum 1. Mai nach Bonn berufen worden. Ich ließ die Fakultät spüren, dass ich gerne seine Stelle in Münster einnehmen würde. Sie kam diesem Wunsche nach, indem sie mich auf die erste Stelle der Vorschlagsliste setzte. Dem Minister Mikat, der mir am 10. 6. 1966 seine Absicht mitteilte, mir die Professur zu übertragen, gab ich die Zusage mit der Begründung, ich verspräche mir „von der Tätigkeit als Ordinarius der Kirchengeschichte eine größere pädagogische Wirkung" (Pflichtvorlesungen) und hoffte, mich meinem Spezialgebiet der Erforschung der Reformationsgeschichte intensiver widmen zu können. Die Ernennung erfolgte durch Kultusminister Fritz Holthoff erst am 9. März 1967.
Die Vorlesungstätigkeit machte mir bis zu meiner Emeritierung (1983) große Freude, über zu geringe Resonanz hatte ich nicht zu klagen. Auch die Zusammenarbeit mit meinen Assistenten und wissenschaftlichen Mitarbeitern war durchweg vorzüglich. Das Klima in der Fakultät, d.h. in den Gremien, besonders in der Fachbereichskonferenz und dem Fachbereichsrat, wurde um so unerträglicher, je mehr die Universität Gruppenuniversität wurde. Bald gab es kaum noch eine Entscheidung, die nicht – anstatt sachbezogen – nach politischen Gesichtspunkten getroffen wurde. Das brachte mich immer mehr dazu, meine Aktivitäten in den außeruniversitären Bereich zu verlagern. In der Diözese Münster übernahm ich den Vorsitz der Kommission für kirchliche Zeitgeschichte und der Ökumenischen Bistumskommission. Ich wurde in den Priesterrat gewählt und 1976 zum Domkapitular ernannt. Außerhalb der Diözese wurde ich Berater der Kommission für Ökumenische Fragen der Deutschen Bischofskonferenz, Mitglied des Vorstandes der Görres-Gesellschaft, des Wissenschaftlichen Beirates des Johann-Adam- Möhler- Instituts für Ökumenik in Paderborn und des Instituts für Europäische Geschichte, Abteilung für Abendländische Religionsgeschichte in Mainz.
Nach langjähriger Mitgliedschaft im Vorstand der Gesellschaft zur Herausgabe des Corpus Catholicorum wurde ich 1972 zu deren Erstem Vorsitzenden gewählt. Dank der Mitarbeit einer Reihe von Kollegen konnte neben einer größeren Anzahl von Monographien die Reihe der Editionen fortgeführt werden. Neben den Messopferschriften des Johannes Eck und Kaspar Schatzgeyers erschien das mit über 100 Auflagen am weitesten verbreitete „Handbuch" vortridentinischer Kontroverstheologie, das „Enchiridion locorum communium adversus Lutherum" von Eck in der vorbildlichen Bearbeitung von Pierre Fraenkel (Genf).
Rechtzeitig zum 450. Gedenkjahr des Augsburger Reichstages von 1530 erschien eine lange fällige Ausgabe der „Confutatio", der Gegenschrift zur „Confessio Augustana". Aus demselben Anlass veranstaltete die Gesellschaft zur Herausgabe des Corpus Catholicorum in Augsburg vom 3. bis 7. September 1979 ein internationales Symposion, an dem gut 100 Gelehrte des In- und Auslandes teilnahmen. Die Referate und Diskussionen sind in „Confessio Augustana und Confutatio. Der Augsburger Reichstag und die Einheit der Kirche" (Münster 1980) festgehalten, und haben große Beachtung gefunden.
Im Januar 1971 wählte die Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz mich zu ihrem ordentlichen Mitglied. Abgesehen von der Ehre ist damit eine einzigartige Gelegenheit zum interdisziplinären Gespräch gegeben. Die Akademie umfasst in drei Klassen, der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen, der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen und der Klasse der Literatur, Vertreter aller Wissenschaften, die zu vierteljährlich stattfindenden Sitzungen von jeweils eineinhalb Tagen zusammenkommen. Die Vorträge werden im Plenum gehalten. So müssen die Vertreter der verschiedenen Disziplinen bemüht sein, sich den Hörern, die nicht Fachkollegen sind, verständlich zu machen, und diese müssen ihrerseits sich mit dem Vorgetragenen auseinandersetzen. Wenn das vielfach nicht gelingt, dann wird dabei zumindest das Elend unserer weitgehend isolierten und desintegrierten Einzelwissenschaft deutlich. Von mir wurde seitens der Akademie die Edition der Werke und Briefe des Bischofs Emmanuel von Ketteler erwartet. Dank des Einsatzes meiner Mitarbeiter sind die fünf umfangreichen Bände der Schriften Kettelers im Jahr 1985 vollständig erschienen. Die Ausgabe hat deutlich gemacht, dass Ketteler mit „Arbeiterbischof" nicht hinreichend charakterisiert ist. Er hat darüber hinaus große Bedeutung bekommen durch seinen Kampf um die Freiheit in einer pseudo-liberalen Gesellschaft und durch sein Bemühen, innerkirchlich das Verhältnis zwischen Papst und Bischofskollegium zu klären. Von den Briefen an und von Ketteler ist der erste Band erschienen; weitere drei bis vier werden folgen.
Somit fehlt es mir auch nach meiner Emeritierung – sie erfolgte am 31. Juli 1983 – nicht an Aufgaben. Meine Abschiedsvorlesung hatte zum Thema: „Die Reformationsgeschichte als Aufgabe des katholischen Kirchenhistorikers."
Soweit meine Kräfte es zulassen, möchte ich auf den hier gewiesenen Pfaden noch eine Strecke weitergehen.