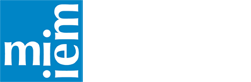Konzept
Disability, Armut und Arbeit im Mittelalter
Studien über Menschen mit Behinderungen sind, was das Mittelalter betrifft, erst um die Jahrhundertwende zunehmend aufgekommen. Sie sind mittlerweile sowohl in den Geschichtswissenschaften als auch in der Philologie und Literaturwissenschaft gut etabliert, vor allem im angelsächsischen Raum, in geringerem Maße auch in Deutschland und anderen Ländern, weniger allerdings in der frankophonen akademischen Sphäre.
Dennoch hat sich die mediävistische Forschung bereits vorher Menschen mit Behinderungen gewidmet, und zwar im Kontext des Themas Armut. Die großen Studien der 1960er bis 1990er Jahre, wie jene von Michel Mollat oder Bronislaw Geremek, gingen oft von der Annahme aus, dass Behinderung und Armut untrennbar miteinander verbunden seien. Die infirmi, so die Autoren, konnten aufgrund ihres hohen Alters oder einer Behinderung nicht arbeiten, und diese Arbeitsunfähigkeit führte zwangsläufig zu Armut. Gleichzeitig stellen Studien zur Armut im Mittelalter Menschen mit Behinderungen als die guten Armen schlechthin dar, die einen legitimen Anspruch auf Almosen hatten, im Gegensatz zu den mendicantes validi, die lasterhaft oder aus Faulheit von der Gesellschaft profitierten. So setzte sich trotz einiger differenzierterer Untersuchungen das bestimmende Bild von bettelnden Menschen mit Behinderungen durch, das seither nicht mehr in Frage gestellt wurde.
In der Tat lädt die mittelalterliche Ikonografie zu solchen Verkürzungen ein, denn die einfachste Art, eine arme Person bildnerisch darzustellen, bestand damals nicht nur darin, sie in Lumpen zu kleiden und sie mit ausgestreckter Hand zu zeigen, sondern auch in der Sichtbarmachung einer Behinderung und den mit ihr verbundenen Gegenständen, Krücken oder Holzbeinen. Darüber hinaus scheinen die umfangreichsten historischen Quellen, wie die Hagiografie einerseits, und die aus den städtischen und praxisorientierten (z.B. von Wohltätigkeitseinrichtungen) überlieferten Dokumenten andererseits, Behinderung und Armut fast immer miteinander zu verbinden.
Das Mediävistische Institut der Universität Freiburg organisiert vom 3. bis 5. September 2025 ein internationales und interdisziplinäres Kolloquium zum Thema „Disability, Armut und Arbeit im Mittelalter“, um diesen Automatismus neu zu hinterfragen. Tatsächlich sind die Kategorien, die hier verknüpft werden, problematisch, da es die Kategorie „Behinderung“ (Disability) nicht gab, während ‚Armut‘ und sogar ‚Arbeit‘ sehr vieldeutig sind und ebenfalls historisiert werden müssen.
Es geht also darum, verschiedene Disziplinen – Geschichte, Kunstgeschichte, Rechtsgeschichte, die verschiedenen Literatur- und Sprachwissenschaften, Theologie, Philosophie, Archäologie – zu mobilisieren, um über die Verbindungen zwischen „Behinderung“, Armut und Arbeit nachzudenken, wobei verschiedene Quellen und Materialien (literarische, ikonografische, normative und praktische) herangezogen werden sollen. Die Tagung bietet die Gelegenheit, gemeinsam über Fragen wie die Präsenz von Menschen mit Behinderungen, die in den Quellen weder als arm noch als inaktiv erscheinen, die soziale Akzeptanz ihrer Inaktivität oder die unterschiedlichen Erfahrungen mit Arbeit oder deren Abwesenheit je nach sozialem Status, aber auch nach Geschlecht der Menschen mit Behinderungen nachzudenken.