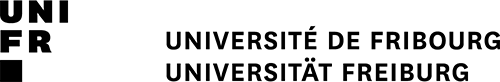Publikationsdatum 28.11.2024
Das Wort des Dekans Joachim Negel - HS 2024/II
Liebe Mitglieder der Theologischen Fakultät
Liebe Freundinnen und Freunde
„Wahrlich, wir leben in finsteren Zeiten!“[1] – so möchte man angesichts der Nachrichten der vergangenen drei Wochen ausrufen. Nicht nur die zweite Präsidentschaft Donald Trumps, sondern der geradezu sturzbachartige Sieg eines Mannes, der, wie selbst viele seiner Wähler zugeben, launisch ist und verlogen, rachsüchtig, egozentrisch, rücksichtslos, krankhaft geltungsbedürftig, bauernschlau und ungebildet zugleich, vulgär, unverhohlen frauenfeindlich, gerne auch mal rassistisch, ressentimentgeladen, infam, niederträchtig, betrügerisch, gewissenlos, moralisch verkommen… Man möchte gar nicht aufhören mit den Pejorativa. Und dieser Mann gewinnt nicht nur zum zweiten Mal die Präsidentschaftswahlen der Vereinigten Staaten, sondern „the people’s vote“, d.h. die Sympathien großer Teile der US-Bevölkerung, darunter überproportional viele Katholiken.
Und dann der Ukrainekrieg, der ja längst mehr ist als irgendein Regionalkonflikt; dieser Krieg hat das Zeug zum Weltenbrand. Da schmiedet der neo-imperialistische Dauer-Präsident Wladimir Putin, der den Phantomschmerz des Zusammenbruchs der Sowjetunion nicht mehr erträgt, seine Koalitionen mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un und den iranischen Mullahs. Die Ideen der Gewaltenteilung, der rechtsstaatlichen Ordnung und der individuellen Freiheitsrechte, für welche die Ukrainer jetzt einen so hohen Preis zahlen, könnten am Ende ja auch Mütterchen Rußland infizieren. Dagegen muß man vorgehen, unbedingt. Patriarch Kyrill, diese klero-faschistische Peinlichkeit, gibt ihren Segen dazu[2]; Papst Franziskus schweigt.
Und wir in Westeuropa? Was ist mit uns? Haben wir, sollte es wirklich zu einer gravierenden wirtschaftlichen Rezession kommen, die nötige Seelenstärke, die Fahne des freiheitlichen Rechtsstaats hochzuhalten, auch wenn uns das persönlich etwas kostet? Würden wir den populistischen Rattenfängern (einem Roger Köppel bei uns in der Schweiz, einem Björn Höcke oder einer Sahra Wagenknecht in Deutschland) widerstehen? Der demokratische Rechtsstaat hat sich bei uns ja nur durchsetzen können, weil dessen Verheißungen in den vergangenen Jahrzehnten begleitet waren von einem kontinuierlichen Anstieg des allgemeinen Wohlstands. Was, wenn Wohlfahrt und Wohlbefinden, welfare und wellness, nicht mehr identisch sind mit freiheitlicher Demokratie.[3] Brechen dann auch bei uns die Dämme?
Und so könnte man fortfahren, müßte vom Terror der Hamas gegen Israel und die palästinensische Bevölkerung sprechen, vom Gaza- und Libanonkrieg, in welchem die israelische Militärmacht höchst fragwürdig agiert. Und dann ist da noch China mit seinem Hunger auf Taiwan, aber auch Syrien, der Sudan und der Jemen, Haiti und Venezuela, die von kleptokratischen Clans in eiserne Zucht genommen werden … man kommt an kein Ende. Ja, in der Tat, wir leben in finsteren Zeiten.
So möchte man reden und sich in sein Schneckenhaus zurückziehen. Aber was soll man dort tun? Das Internet mit seinen Bubbles hilft nicht weiter, Trübsal blasen ist auch keine Lösung, und den eigenen kleinen Garten bestellen („il faut cultiver notre jardin“)[4] mag zwar für den Moment Ablenkung bringen, ändert aber nichts an den Weltumständen. Über kurz oder lang wird man sich mit ihnen beschäftigen müssen – denn über kurz oder lang werden sie sich mit uns beschäftigen, ob uns das gefällt oder nicht.
Hier angelangt, ist nun doch an ein vom gegenwärtig eher schweigsamen Papst Franziskus verfaßtes Schreiben zu erinnern. Veröffentlicht wurde es Anfang August in Gestalt eines persönlichen Briefes, der zunächst an die Verantwortlichen in der Priesterausbildung adressiert war. Aber da die dort angesprochene Thematik jeden Menschen etwas angeht, der auch nur ein wenig aufmerksam ist für die Welt um ihn herum, ist dieser Brief eigentlich an alle adressiert. Der Titel „Über die Bedeutung der Literatur in der Bildung“[5] mutet etwas spröde an; aber kaum hat man begonnen zu lesen, ist man gepackt:
Oft, so die erste Beobachtung dieses Briefes, kann uns „ein gutes Buch […] eine Oase“ sein. „In den Momenten der Müdigkeit, des Ärgers, der Enttäuschung, des Scheiterns, wenn es uns nicht einmal im Gebet gelingt, zur Ruhe zu kommen, hilft ein gutes Buch […], den Sturm zu überstehen, bis wir ein wenig mehr Gelassenheit finden […]. Und vielleicht eröffnet uns die Lektüre neue innere Räume, die uns helfen, uns nicht in […] zwanghaften Ideen zu verschließen […]. Vor der Allgegenwart der sozialen Netzwerke, Mobiltelefone und anderen Geräte war dies eine häufige Erfahrung, und diejenigen, die sie gemacht haben, wissen, wovon ich spreche. Das ist nicht etwas Überholtes.“[6]
Warum die Lektüre eines Romans, einer Novelle, eines Gedichts für unser Selbst- und Welterleben so bedeutsam ist, erläutert Papst Franziskus dann wie folgt: „Im Gegensatz zu den audiovisuellen Medien […] ist der Leser beim Lesen eines Buches viel aktiver. Er schreibt das Werk in gewisser Weise um, erweitert es mit seiner Vorstellungskraft, erschafft eine Welt, nutzt seine Fähigkeiten, sein Gedächtnis, seine Träume, seine eigene Geschichte […], und so entsteht ein Werk, das sich von dem unterscheidet, das der Autor zu schreiben beabsichtigte. Ein literarisches Werk ist also ein lebendiger und stets fruchtbarer Text, der in der Lage ist, […] mit jedem Leser […] eine originelle Synthese zu bilden. Bei der Lektüre wird der Leser durch das, was er vom Autor erhält, bereichert, was ihm aber gleichzeitig erlaubt, sich im Reichtum seiner eigenen Person zu entfalten, so dass jedes neue Werk, das er liest, sein persönliches Universum erneuert und erweitert.“[7]
Und dann bietet Franziskus eine ganze Serie von Beispielen aus seinen eigenen Lektüreerfahrungen: da ist das Weinen eines verlassenen Mädchens, dessen eindringliche Darstellung ihn berührt; die Zärtlichkeit der alten Frau, die ihren schlafenden Enkel zudeckt; die heldenhaften Bemühungen des kleinen Geschäftsmannes, trotz aller Schwierigkeiten über die Runden zu kommen; die Demütigung eines Menschen, der sich von allen kritisiert fühlt; der Junge, der als einzigen Ausweg aus dem Schmerz eines unglücklichen und rauen Lebens seine Träume besitzt. – In die Welt eines Buches einzutauchen, bedeutet, mit den eigenen Erfahrungen in andere Welten einzutreten, bedeutet, feinfühliger zu werden für die Erfahrungen der anderen, deren Kämpfe und Sehnsüchte ein wenig besser zu verstehen, die Wirklichkeit mit ihren Augen zu sehen und dadurch sukzessive zu deren Weggefährten zu werden. Wir tauchen ein „in die konkrete, innere Existenz des Obstverkäufers, der Prostituierten, des Kindes, das ohne die Eltern aufwächst, der Frau des Maurers, der alten Frau, die immer noch glaubt, ihren Prinzen zu finden. Und wir können dies mit Einfühlungsvermögen und manchmal mit Duldsamkeit und Verständnis tun.“[8]
Ob in den gegenwärtigen, politisch so unsicheren Zeiten nicht gerade die Literatur unseren Horizont weiten kann? Was gäbe es da zu lesen? Die Empfehlungen, die ich im folgenden ausspreche, sind natürlich von den Vorlieben und Zufällen der eigenen Lektüreerfahrungen bestimmt; aber sie sind auch nicht einfach nur subjektiv.
So erinnere ich im Blick auf ein tieferes Verständnis von Putins Krieg gegen die Ukraine an die große Amadoka-Trilogie von Sofia Andruchowytsch (Die Geschichte von Romana, … von Uljana, … von Sofia)[9], eine eindringliche Schilderung des Holodomor, der von Stalin den ukrainischen Kleinbauern in den Jahren 1931-1933 verordneten Zwangskollektivierung, in Folge derer bis zu sieben Millionen Ukrainer verhungerten. Im Blick auf das gegenwärtige Russland und seine verdrängte stalinistische Vergangenheit seien ferner die Werke von Waram Schalamow (Erzählungen aus der Kolyma 1-4)[10] empfohlen, unbedingt aber auch Wassili Grosmans monumentales Gesellschaftsepos Leben und Schicksal, eines der wichtigsten Werke der russischen Literatur und wohl nur mit Tolstois Krieg und Frieden zu vergleichen. Thema dieses Epos ist der Überfall Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion und der Zusammenprall zweier Totalitarismen.[11]
Wer etwas vom Israel-Palästina-Konflikt verstehen will, lese die Bücher von Amoz Oz (Eine Geschichte von Liebe und Finsternis)[12] und David Grossman (Eine Frau flieht vor einer Nachricht)[13] sowie den Roman der arabisch-israelischen Schriftstellerin Adania Shibli (Eine Nebensache), die derzeit führende literarische Stimme Palästinas.[14]
Wer sich eine Ahnung erhalten möchte, daß in allem Irrsinn es möglich ist, Spuren tiefer Menschlichkeit zu finden, dem empfehle ich die Bücher des polnischen Romanciers Andrzej Szcipiorski (Die schöne Frau Seidenmann[15] und Eine Messe für die Stadt Arras[16]) sowie die Novelle Was gibt’s Neues vom Krieg? des französischen Literaten und Regisseurs Robert Bober.[17]
Jenseits der großen Irrungen und Wirrungen der Welt wäre natürlich auch und unbedingt an die verstörenden oder betörenden Geschichten des Kleinen, Privaten, Persönlichen zu erinnern: Dazu die lakonischen Gedichte von Mascha Kaléko (Verse für Zeitgenossen)[18] oder die schmerzlichen Gedichte von Nelly Sachs, Gertrud Kolmar und Else Lasker-Schüler, und dann natürlich die großen europäischen Bildungsromane von Goethe (Wilhelm Meister), Stendhal (Le Rouge et le Noir; Éducation sentimentale; La Chartreuse de Parme) und Gottfried Keller (Der grüne Heinrich), aber auch die kleinen, nicht weniger bedeutsamen Bildungsromane bzw. -erzählungen von Robert Seethaler (Ein ganzes Leben)[19], Dieter Wellershoff (Der Himmel ist kein Ort)[20], Hanns-Josef Ortheil (Die Erfindung des Lebens)[21] und Fred Uhlman (Der wiedergefundene Freund).[22]
Und so könnte man endlos fortfahren, denn „von allen Welten, die der Mensch erschaffen hat, ist die der Bücher die gewaltigste.“ [23] Dies gilt auch und nicht zuletzt von der Bibel, die ja nicht nur Offenbarungsurkunde für Juden und Christen ist, sondern in vielen ihrer Passagen zunächst einfach großartige Literatur (man denke an das Buch Hiob und die Psalmen, an den Kohelet, an die Klagelieder des Jeremias, an das Hohelied der Liebe, an die Evangelien oder die Apostelgeschichte usf.). Große Literatur, wie die Bibel sie präsentiert, greift in unser Leben ein; in der Verwandlung des Blicks auf uns selbst verwandelt sie uns selbst und mit uns – die Welt. Und plötzlich versteht man, weshalb den Potentaten gute Bücher so gefährlich sind. Sie bergen Dynamit in sich, der alle eingefahrenen Gleise sprengen könnte.
Damit geraten wir an den Anfang unserer Überlegungen: Was soll man tun in finsteren Zeiten wir diesen?, so fragten wir.[24] Man könnte lesen, lautet die Antwort; wenigstens das. Denn das Lesen großer Literatur wie der genannten tröstet nicht nur; es schafft Raum zum Atmen und klärt den Blick – m.a.W.: Es lehrt uns sehen, was ist. „Wer wirklich sehen lernt, nähert sich dem Unsichtbaren“[25], so Papst Franziskus am Ende seines Briefes in Rückgriff auf Paul Celan. Mit Albert Camus, einem meiner agnostischen „Kirchenväter“, kann man dasselbe etwas prosaischer sagen. Irgendwo in einem seiner frühen Essays heißt es: „Willst du Philosoph sein, schreib‘ Romane!“ Ich hätte große Lust, diesen Satz ein wenig umzuformen und ihn dann allen unseren Studentinnen und Studenten, Kolleginnen und Kollegen und vor allem mir selbst gehörig hinter die Ohren zu schreiben. Der Satz lautete: „Willst du Theologe sein, lies Romane!“ Ja, lesen wir Romane, nehmen wir uns die nötige Zeit, Gedichte zu lesen und Novellen und Erzählungen und, und, und. Unsere Theologie würde lebensnäher und wirklichkeitsgesättigter. In unserem Reden von Gott rührten wir an Ihn, den Unsagbaren, und damit an die Welt. Wir brächten Ihn/Es behutsam ins Wort und damit uns und die Welt, gerade jetzt in diesen finsteren Zeiten.
Joachim Negel
Dekan
[1] Vgl. Bertolt Brecht, An die Nachgeborenen, in: Gesammelte Gedichte, edition suhrkamp, Frankfurt a.M. 1976, Bd. 2, 722-725.
[2] Jörg Himmelreich, Die russisch-orthodoxe Kirche als Kriegstreiberin, in: NZZ, 18. November 2024, S. 19. – Vgl. dazu auch die Reaktion des Patriarchen von Konstantinopel, Bartholomaios: https://www.katholisch.de/artikel/41644-wegen-haltung-zum-krieg-bartholomaios-legt-kyrill-ruecktritt-nahe (aufgerufen am 26.11.2024).
[3] Vgl. Jean-Pierre Wils, Verzicht und Freiheit. Überlebensräume der Zukunft, Stuttgart 2024.
[4] Voltaire, Candide chap. XXX.
[5] https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2024-08/papst-franziskus-brief-lekture-literatur-ausbildung-bedeutung-dt.html (aufgerufen am 25. November 2024).
[6] Ebd. Kap. 2.
[7] Ebd. Kap. 3.
[8] Ebd. Kap. 36.
[9] Salzburg: Residenz, 2023/24.
[10] Berlin: Matthes & Seitz, 2007-2016.
[11] Berlin: List, 2008/42016.
[12] Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2004.
[13] München: Hanser, 2009.
[14] Berlin: Berenberg, 2022.
[15] Zürich: Diogenes, 1991.
[16] Zürich: Diogenes, 1991.
[17] München: Verlag Antje Kunstmann 1995.
[18] München: Deutscher Taschenbuchverlag, 82017.
[19] München: Goldmann-Verlag, 2016.
[20] Köln: Kiepenheuer & Witsch 2009.
[21] München: Luchterhand, 2009; danach München: btb Verlag, 2011-2024.
[22] Köln: Hermansen, 1979; danach Zürich: Diogenes, 1998.
[23] Hermann Hesse, Magie des Buches, Sämtliche Werke, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2003, Bd. 14, 403.
[24] S.o. Fußnote 1.
[25] Papst Franziskus, Brief „Über die Bedeutung der Literatur in der Bildung“ (s.o. Fußnote 5), Kap. 44 (zitiert Paul Celan, „Mikrolithen sinds, Steinchen“, in: Die Prosa aus dem Nachlaß, Berlin: Suhrkamp, 2005, Nr. 24.1).