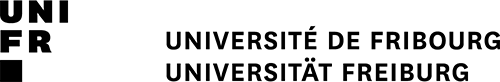Publikationsdatum 21.12.2023
Das Wort des Dekans Joachim Negel - HS 2023/III
Liebe Mitglieder der Theologischen Fakultät
Liebe Freundinnen und Freunde
Wenn die Adventszeit eine Zeit des Wartens ist auf den Erlöser, eine Zeit des sehnsuchtsvollen Sich-Ausstreckens, des Sich-Geduldens, ja des Ausreifen-Lassens, da man nichts erzwingen kann, dann war es in diesem Jahr mit dem Advent nicht viel. Alle sieben Jahre fällt der Vierte Adventssonntag auf den 24. Dezember, und so dauert die Adventszeit alle sieben Jahre nur drei Wochen. Und schon ist Weihnachten, eine regelrechte Sturzgeburt. Was kann uns das sagen?
Zunächst sicherlich dies: Die Kürze der diesjährigen Adventszeit (so sehr sie uns vom Kalender vorgegeben ist) ist in gewisser Weise Spiegel unserer Unfähigkeit zu Langsamkeit und Geduld. Die Moderne produziert einen regelrechten Zeitnotstand; wir leben in permanentem Steigerungsmodus. Nur ein Beispiel: Wieviel Zeit verbrachte man noch vor einer Generation mit dem Briefeschreiben! Und so überlegte man sich genau, wann, wem und warum man Briefe schrieb. Geschäftsbriefe schrieb man, wenn sie nötig waren, sonst ließ man es; und für Freundschafts- oder Verwandtenbriefe, handschriftlich verfaßt mit der Feder auf Papier, nahm man sich Zeit, und zwar, weil es Zeit braucht, um einen guten Brief zu schreiben. Wenn ich nun aber in derselben Zeit, in welcher ich einen Brief schreibe, fünf E-Mails verfassen kann, dann gerate ich unter Druck, denn alle Mails, die ich versende, verdoppeln und verdreifachen den Kommunikationsverkehr – mit anderen Worten: Meine Zeit nimmt, subjektiv empfunden, ab, obwohl ich in derselben Zeit viel mehr erledige. Zugleich wird die Zeit aber auch leerer: Ich bin ständig am Rotieren und weiß immer weniger, was ich mit mir anfangen soll.
Der Jenaer Soziologe Hartmut Rosa hat diese Zusammenhänge eindringlich analysiert; er spricht von einem permanenten Steigerungsmodus, in welchem wir leben. Wachstum und Beschleunigung seien gleichsam das Nervensystem der kapitalistischen Moderne.[1] Obwohl uns die technischen Mittel tausend Arbeiten abnehmen und wir dadurch immer mehr Zeit gewinnen, haben wir immer weniger Zeit. Jeder kennt dieses paradoxe Phänomen: Je mehr Möglichkeiten die Welt uns bietet, umso weniger bleibt für den einzelnen Menschen oder die einzelne Sache. Die To-Do-Listen werden immer länger, obwohl (oder vielleicht gerade weil) wir immer mehr arbeiten. Und das geht nicht spurlos an uns vorbei. Die Multioptionsgesellschaft überfordert uns. Der Optimierungswahn treibt in den Wahnsinn; ständig müssen die Dinge evaluiert werden, da ist immer noch Luft nach oben („Wie haben Sie Ihre heutige Reise erlebt?“, so der Aufkleber auf dem Sitz in der Bahn, darunter der Barcode zum Scannen: „Wo können wir uns verbessern? Sagen Sie’s uns!“). Die Kognitionswissenschaftler sprechen von Reizüberflutung auf allen Ebenen: Beim Barista gibt es nicht drei Kaffeesorten, sondern zweiunddreißig; im Supermarkt finden sich siebenundzwanzig Joghurtvarianten statt drei. Gab es vor fünfzig Jahren ganze zwei Fernsehkanäle (Sendebeginn war um 15.00 Uhr, Sendeschluß um 22.00 Uhr), so buhlen heute die „News“ im Minutentakt um unsere Aufmerksamkeit – man muß „auf dem Laufenden“ sein, wer nicht auf dem Laufenden ist, ist „out“. Die Mediziner sprechen vom „Burnout“ als dem Krankheitsbild unserer Zeit.
Wir heilsam wäre da ein wirklicher Advent! Eine Zeit des Schweigens, Wartens, Hoffens, Betens. Eine Zeit echter „Langeweile“, eines langen geduldigen Weilens, Verweilens.
Das Problem ist freilich, daß der einzelne an diesen Zusammenhängen wenig ändern kann. Die Art, wie wir mit Zeit umgehen, die Zeitstrukturen, Zeitmuster und Erwartungshaltungen, sind kollektiv verankert. Die Universität als Wissensmaschine der kapitalistischen Moderne bleibt davon ebenso wenig unberührt wie ihre Theologische Fakultät. Auch bei uns Theologen, die wir doch eigentlich wissen müßten oder wenigstens wissen sollten, was „Advent“ ist, hetzt eine Konferenz die nächste, folgt eine Tagung auf die andere, löst ein Forschungsantrag den kommenden ab. Einwerbung von „Drittmitteln“, darin liegt das Heil. Wer hingegen ruhig in seinem Studierzimmer sitzt („Bleib in deinem Kellion“, mahnten die Wüstenväter), wer konzentriert liest und schreibt und Gott nachdenkt und dabei vielleicht sogar betet (Was für eine Anachronismus!), gehört einer Welt an, die es nicht mehr gibt. Kann es da überraschen, daß wir kaum noch an Gott glauben? Wir leben ja auch nicht mehr im Advent. Und ohne Advent, ohne die lange Weile, keine Ankunft Gottes in unserem Fleisch.
Wie hierauf antworten? Vielleicht mit der Erinnerung an die Tatsache, daß alles Leben aus einem einsam vernehmenden und gemeinsam ausgetragenen Schweigen geboren wird. Es ist nun einmal so: Niemand hat sich selbst gezeugt, niemand hat sich selbst geboren, wir finden uns vor, wir erwachen zu uns selbst, wir sind uns anvertraut, wachsen langsam ins Leben hinein. Wir sind nie die Macher unserer selbst, wir sind uns (vor)gegeben, wir empfangen uns. Wie der mütterliche Ackerboden den Samen beherbergt, ihn sprossen läßt und fruchtend freigibt (vgl. Jes 55,10f.), so verhält es sich mit dem Leben insgesamt: Das Leben ist Advent, Ankunft aus einer unvordenklichen Stille.
Und damit gelangen wir nun doch beim Weihnachtsfest an, bei der Geburt des göttlichen Wortes in Christus, der Mensch werden will ins uns: „Als tiefes Schweigen das All umfing und die Nacht bis zur Mitte gelangt war, da sprang dein allmächtiges Wort vom Himmel herab […]. Das Wesen der ganzen Schöpfung wurde neugestaltet; sie gehorchte deiner Weisung, damit deine Kinder unversehrt bewahrt blieben.“ (Weish 18,14f.; 19,6) Ein herrlicher Text aus dem jüdischen Buch der Weisheit, verfaßt in Alexandria in griechischer Sprache wenige Jahrzehnte vor der Zeitenwende, gegen 80 bis 30 v.Chr. Ein unvordenkliches Wissen macht sich hier kund: Stille scheint der Anfang von allem zu sein, Wiege und Vollendung aller Wirklichkeit, das Umfassende. Verhält es sich nicht wirklich so? Im Schweigen erahnen wir, wie einsam wir sind, abgründig einmalig. Aber gerade in dieser Einmaligkeit entdecken wir uns als uns zugesprochen, zugemutet, zugetraut. Was, wenn wir uns jenen adventlichen Fragen stellten, die wir nur selten an uns heranlassen, weil wir sie aus eigener Kraft nicht beantworten können: „Woher bin ich?“ „Wohin gehe ich?“ „Gibt es Gott?“ „Was ist mit den Toten?“ „Was ist mit mir?“ „Was soll das Ganze hier?“ „Wer bin ich eigentlich?“
Auf Fragen wie diese kann uns keine Soziologie die Antwort geben, keine Psychologie, keine Ökonomie und keine Politik, und auch Philosophie und Theologie sind von ihnen heillos überfordert. Denn es sind Fragen, auf die niemand sich selbst die Antwort geben kann – es sei denn, seine Antwort wäre Resonanz jenes unvordenklichen Wortes, von welchem es heißt, es sei „in der Mitte der Nacht, als tiefes Schweigen das All umfing, vom Himmel herabgesprungen“, um Mensch zu werden in uns wie es Mensch geworden ist in Jesus, dem Christus.
Vielleicht gibt es sie ja doch, jene Stille und jenes Schweigen, in welchem aufklingt, was kein Mensch sich selber sagen kann. Ich wünsche Ihnen den Segen jenes Logos, der die Kühnheit hatte, infans zu werden.
Joachim Negel, Dekan
[1] Hartmut Rosa, Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 2005 / 112016; ders., Weltbeziehungen im Zeitalter der Beschleunigung. Umrisse einer neuen Gesellschaftskritik, Berlin, Suhrkamp 2012 / 32016. – Dazu aus theologischer Sicht Tobias Kläden / Michael Schüßler (Hg.), Zu schnell für Gott? Theologische Kontroversen zu Beschleunigung und Resonanz (Quaestiones disputatae 286), Freiburg i.Br., Herder 2017.