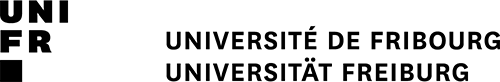Publikationsdatum 21.11.2023
Das Wort des Dekans Joachim Negel - HS 2023/II
Liebe Mitglieder der Theologischen Fakultät
Liebe Freundinnen und Freunde
« Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten… », mit diesen Worten beginnt eines der berühmtesten Gedichte von Bertolt Brecht. Verfaßt hat er es in den 1930er Jahren im Schwedischen Exil, und überschrieben ist es mit dem Titel : « An die Nachgeborenen ». An sie, die Generation nach ihm, ist das Gedicht adressiert, und es endet mit der zaghaften Bitte, die Nachgeborenen möchten nachsichtig sein mit ihm, Bert Brecht, und seiner Generation, da sie es nicht vermochten, dem Bösen zu widerstehen ; da sie zu schwach waren, der dummdreisten Gewalt das Wasser abzugraben ; unfähig, Friede und Gerechtigkeit zu bewahren.
« Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten… » Ob wir in ähnlichen Zeiten leben wie damals Brecht ? Sicher nicht. Die Schweiz ist ein weltweit beneideter Hort des Wohlstands und der Rechtsstaatlichkeit ; Deutschland, Frankreich, die Niederlande, Belgien und viele weitere Länder der Europäischen Union sind stabile Demokratien. Es ist kaum ein Zufall, daß Millionen Migranten aus den Ländern Afrikas, des Nahen und Mittleren Ostens, aus Rußland, dem Iran, Afghanistan und vielen anderen Ländern nur einen Wunsch haben : nach Westeuropa zu kommen, weil man hier in Sicherheit leben kann. Wer wollte es ihnen verargen ?
Gleichwohl scheinen immer weniger Europäer diese Errungenschaften wertzuschätzen. Nicht nur bei den englischen Brexiteers, bei den Anhängern der Staatsparteien Ungarns, Polens und der Slowakei, auch in Frankreich, Italien, Deutschland und anderen europäischen Gesellschaften wächst die Zahl derer, die sich nach der harten Hand des autoritären Führers (zurück)sehnen und nach dem starken, nationalen Staat. Demokratie ist anstrengend, keine Frage, sie erfordert die Fähigkeit, Kompromisse zu schließen, bereit zu sein, auf den anderen zuzugehen, sich von ihm in Frage stellen zu lassen. Demokratie bedarf innerer Stärke, und zugleich verlangt sie eine gehörige Portion Gelassenheit, Freude am anderen und nicht zuletzt Humor. Wo dies alles fehlt, da läuft man Gefahr, sich zu verhärten, da schließt man sich ein in seiner Opferrolle (der realen wie der eingebildeten), da wird der Blick hart ; Auge und Herz verengen sich, am Schluß sind da nur noch Schießscharten. Und so wird der andere zum Ziel. Und irgendwann schießt man.
Dessen sind wir vor sechs Wochen auf fürchterliche Weise Zeuge geworden, an genau jenem Tag, an dem die Juden das Fest « Simchat Tora » feiern ; mit ihm schließt das Laubhüttenfest. Am frühen Morgen des 7. Oktober drangen Terrorgruppen der Hamas vom Gazastreifen kommend auf israelisches Staatsgebiet vor. Sie fielen in zahlreiche grenznahe Militärposten, Ortschaften und Kleinstädte in Südisrael ein und verübten dort Massaker an der Zivilbevölkerung. Über 1.200 Zivilisten und Sicherheitskräfte wurden ermordet, mehr als 5.400 Menschen verletzt und rund 250 weitere entführt. Es handelt sich um den größten Massenmord an Juden seit dem Holocaust. Als Reaktion auf den Angriff rief Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu den Kriegszustand aus – zum ersten Mal seit 50 Jahren. Und so herrscht Krieg – und was für einer. Die Zivilbevölkerung in Gaza, von der Hamas als Geisel genommen, hat unter den Vergeltungsschlägen der IDF (Israel Defense Forces) massiv zu leiden, und die Hamas in ihrem Zynismus freut das. Denn hier wird die Saat für die nächsten 30 Jahre Krieg gelegt, hier wächst eine neue Generation von Kämpfern heran. Wer nichts zu verlieren hat, hat eben nichts zu verlieren. Wieso sollte er sich um Frieden und Ausgleich bemühen? Er hat ja eh nichts zu gewinnen. Die seit den späten 1990er Jahren andauernde Siedlungspolitik Israels im Westjordanland hat einer Zwei-Staaten-Lösung jede Möglichkeit verbaut, und zwar im Wortsinn. Die lachenden Dritten sind einmal mehr die Zyniker in Iran und Afghanistan, aber auch die Neo-Imperialisten Putin, Erdogan, Ali Asadov und Konsorten.
Und Europa? Welche Reaktionen ruft der Gaza-Krieg bei uns hervor? Die Antwort ist alles andere als schön. Mögen die Schweiz und Europa von Krieg und Terror auch weit entfernt sein, so vernebeln der Krieg in Gaza und Israel auch bei uns die Gehirne. Und so taucht in Reaktion auf die Selbstverteidigung Israels gegen den Hamas-Terror mitten in unserem zivilisierten Europa plötzlich etwas auf, das man definitiv überwunden glaubte : die Fratze des Antisemitismus in ihrer gedankenlosen, ja schäbigen Form. Diese Fratze taucht auch und gerade an den Universitäten auf, nicht zuletzt bei jenen, die glauben, gegen jede Form von Rassismus gefeit zu sein, weil sie ja auf der moralisch richtigen Seite stünden : bei den Vertretern des anti- und postkolonialistischen Diskurses. Man ist sprachlos. Und schämt sich. Und fragt sich, was hier eigentlich gerade passiert.
Warum will es nicht gelingen, Vernunft, maßvolles Regieren und Ausgleich der verschiedenen Interessen unter einen Hut zu bringen ? Ob der Mensch intrinsisch friedensunfähig ist ? Und jeder Friede immer nur die Pause zwischen zwei Kriegen ?
Mit Fragen wie diesen geraten wir nicht nur vor historische, politische und ökonomische, sondern vor emminent anthropologische Fragen. Anthropologische Fragen sind freilich stets mehr als nur anthropologische Fragen. In ihnen leuchtet etwas auf, das größer ist als der Mensch. Warum ist das so ? Eine Antwort deutet sich an bei Blaise Pascal : « L’homme surpasse l’homme infiniment ». Ähnlich Thomas von Aquin : « homo definiri nequit ». Es ist einfach so : Der Mensch läßt sich auf keine Summenformel bringen. Mögen die Vertreter eines szientifischen Naturalismus da auch anderer Meinung sein, so steht doch fest, daß der Mensch sich selbst entzogen bleibt, er ist Engel und Teufel zugleich, er wird sich selber immer wieder zum Rätsel. Der Gazakrieg, ähnlich wie der Krieg Rußlands gegen die Ukraine, zeugen hiervon auf bestürzende Weise. Was aber dann ?
Diese Frage, liebe Freundinnen und Freunde unserer Fakultät, liebe Kommilitoninnen und Kollegen, brennt uns einmal mehr auf den Nägeln. Eine Antwort wird sich kaum den Parolen der Empörung entnehmen lassen, sondern einzig der leisen Stimme der Vernunft. In ihr leuchet etwas auf, das Menschen nur in sehr begrenztem Maße zu verwirklichen imstande sind : ein Friede, der mehr ist als die zeitweilige Abwesenheit von Krieg. In der biblischen Tradition gibt es hierfür ein Wort : « Schalom ». Schalom meint « Ruhe, Hege, Milde, Güte, Vertrautheit, Freundschaft, Stille, Sättigung, tiefe Befriedigung » und vieles mehr. Von diesem Frieden heißt es, die Welt könne ihn « sich selber nicht geben » (Joh 14,27), denn er sei « höher als alle Vernunft » (Phil 4,7). Und doch sei die Welt elementar verantwortlich für ihn : « Habt Salz in euch und haltet Frieden ». (Mk 9,50b) Daß wir beides uns zu Herzen nehmen, unsere Verantwortung für die Welt und die Sehnsucht nach jenem Frieden, den die Welt sich selber nicht geben kann, das sei mein Wunsch für uns in diesen finsteren Zeiten.
Joachim Negel, Dekan