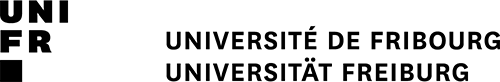Publikationsdatum 26.02.2022
Das Wort des Dekans, Mariano Delgado - FS 2022/I
Welches Christentum für unsere Zeit?
In der Bibel finden wir zwei Formen von Verständnis des Reiches Gottes und der Beziehung des Menschen dazu: eine mehr ontologisch-kultische und eine eher messianisch-prophetische. Die erste neigt zum Ritualismus, die andere zu einem Verständnis des Reiches Gottes als Reich der Gerechtigkeit und des Friedens, der Wahrheit und der Freiheit, das auch in dieser Welt Gestalt nehmen muss. In der letzten Kirchenepoche haben die Vertreter und Vertreterinnen eines messianisch-prophetischen Christentums nicht gefehlt, aber der Ritualismus als Pathologie hatte, wie zur Zeit Jesu im Judentum, zuweilen ein Übergewicht – und dagegen wandten sich Humanisten, Reformatoren und Mystiker in der Renaissance. Das messianisch-prophetische Christentum in der Einheit von Mystik und Politik wird das Markenzeichen der neuen Kirchenepoche, der Kirche des 3. Jahrtausends sein, wenn man die ihm eigene Pathologie, das Zelotentum oder den Versuch zur gewaltsamen Herbeiführung des Reiches Gottes, überwindet. Denn der Zweck heiligt nicht die Mittel.
Eine der Fragen, die in der neuen Kirchenepoche von zentraler Bedeutung sein werden, ist die nach dem Ort, wo der Herr wohnt und gesucht werden soll.
Eine der Fragen, die in der neuen Kirchenepoche von zentraler Bedeutung sein werden, ist die nach dem Ort, wo der Herr wohnt und gesucht werden soll. Auf die Frage «Meister –, wo wohnst du?» (Joh 1,38) gibt die christliche Tradition – abgesehen von der sakramentalen Gegenwart in der Eucharistie – grundsätzlich zwei Antworten:
Eine Antwort beruft sich auf Joh 14,23: «Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten; mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen». Demnach ist Gott in unserem Inneren, im «Seelengrund» zu suchen, denn hier hat er seine Wohnung aufgeschlagen und von hier aus lädt er uns zärtlich zur Freundschaft ein, zum inneren Beten als Liebesgespräch. Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis fallen hierbei zusammen. Mit diesem neuplatonisch-augustinischen Traditionsstrang setzt die «radikale Verjenseitigung» des Reiches Gottes und die Individualisierung der Geschichte an, die ein Adolf von Harnack um 1900 für das «Wesen des Christentums» gehalten hat. Einiges ist daran von bleibender Bedeutung, und es gilt heute grundsätzlich, wie bei vielen Fragen der Kirchengeschichte, das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten.
Eine andere Antwort will – im Anschluss an Mt 25,40 («Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan») – den Herrn draussen, in den Armen und Leidenden suchen. Es ist das messianisch-prophetische Christentum, das vom Tun der Liebe ausgeht. Diese Tradition hat das Zweite Vatikanische Konzil am Übergang zur neuen Kirchenepoche betont, wenn es in Lumen gentium 8 heisst, dass die Kirche in den Armen und Leidenden das Bild dessen erkennt, «der sie gegründet hat und selbst ein Armer und Leidender war. Sie müht sich, deren Not zu erleichtern, und sucht Christus in ihnen zu dienen». Ähnliches sagt das Konzil in Gaudium et spes 1.
In der neuen Kirchenepoche wird man die Liebesmystik zu Christus im Seelengrund und die Verbindung von Mystik und Politik bei der Suche des Herrn in den Armen und Leidenden und im Kampf gegen jedes Unrecht, das wir ändern können, deutlicher als bisher miteinander verbinden müssen.
Diese zwei Formen der Gottesbegegnung sind nicht antithetisch, sondern komplementär. In der neuen Kirchenepoche wird man beide Antworten – die Liebesmystik zu Christus im Seelengrund und die Verbindung von Mystik und Politik bei der Suche des Herrn in den Armen und Leidenden und im Kampf gegen jedes Unrecht, das wir ändern können – deutlicher als bisher miteinander verbinden müssen. Wir sind gewohnt, die hervorragenden Vertreter und Vertreterinnen des ersten Typus zu Heiligen zu erklären, aber mit den Christen und Christinnen des zweiten Typus hat die Kirche oft ihre Mühe.
Ein Zeichen dafür, dass man auch in diesem Bereich die Zeichen der Zeit für den Übergang in die neue Kirchenepoche verstanden hat, ist die Selig- und Heiligsprechung von Oscar Romero (2015/2018) und jüngst (22.01.2022) auch die Seligsprechung des Jesuiten Rutilio Grande durch Papst Franziskus. Romero war zunächst ein angepasster Kleriker, ein typischer Vertreter der lateinamerikanischen Priestereliten, die zu höheren Studien nach Rom geschickt werden und dann stromlinienförmig bleiben – in der Hoffnung auf ein Bischofsamt oder auf andere kirchliche Würden. Seine Seelsorge war konventionell, angesichts der Armut eher an Wohltätigkeit als an Gerechtigkeit appellierend. 1970 wurde er in diesem Geist zum Weihbischof in San Salvador ernannt. Von 1974 bis 1977 war er Bischof der Diözese Santiago de María, und in dieser Zeit scheint bei ihm ein innerer Wandlungsprozess aufgrund konkreter Erfahrungen einzusetzen: durch die Wahrnehmung des Elends der Campesinos, der politischen und strukturellen Dimension der zugrunde liegenden Probleme sowie der Repression durch die Nationalgarde.
Bischof Romero machte den Weg von der traditionellen Wohltätigkeit zu der Anklage der Strukturen bzw. der Ursachen von Armut und Ungerechtigkeit mit.
Und dennoch blieben diese inneren Veränderungen weitgehend unbemerkt, denn sonst wäre er nicht 1977 zum Erzbischof von San Salvador ernannt worden. Nach der Ermordung von Rutilio Grande am 12.3.1977, weil dieser kurz davor eine prophetische Predigt gegen die Ungerechtigkeit gehalten hatte, war Romero ein anderer Mensch, ein veränderter Bischof. Er machte den Weg von der traditionellen Wohltätigkeit zu der Anklage der Strukturen bzw. der Ursachen von Armut und Ungerechtigkeit mit. Romeros Ansehen als Verteidiger der Menschenrechte und Mann des Dialogs wuchs von Tag zu Tag, auch im Ausland.
Am 2.2.1980, wenige Wochen vor seiner Ermordung am 24.3.1980, hielt Romero anlässlich der Verleihung des Ehrendoktorats in Löwen eine aufsehenerregende Rede über «Die politische Dimension des Glaubens und die Option für die Armen»: «Weil sie sich für die wirklich Ausgebeuteten und Unterdrückten entschieden hat, lebt die Kirche im Bereich des Politischen, und sie verwirklicht sich als Kirche auch im Bereich des Politischen. Das kann nicht anders sein, wenn sie sich wie Jesus an die Armen wendet.» Zusammenfassend heisst es darin am Ende: «Die ersten Christen sagten: Gloria Dei, vivens homo. Wir könnten konkreter sagen: Gloria Dei, vivens pauper – die Ehre Gottes ist der Arme, der lebt. Wir glauben, dass wir – von der Transzendenz des Evangeliums her – sagen können, was wirkliches Leben für die Armen ist, und wir glauben auch, dass wir wissen werden, was die ewige Wahrheit des Evangeliums ist, wenn wir an der Seite der Armen stehen und versuchen, ihnen Leben zu ermöglichen. Die politische Dimension des Glaubens entdeckt man nur im praktischen und konkreten Dienst an den Armen».
Die Predigt, die Romero am Tag seines Todes in der Krankenhauskapelle hielt, handelte vom Weizenkorn, dem Tagesevangelium. Bei der Opfergabe fiel dann der tödliche Schuss.
Bischof Romero entdeckte den ethisch-prophetischen Religionstyp, der vom Hunger und Durst nach Gerechtigkeit sowie vom Tun der Liebe geprägt ist, als Matrix des Christentums. Als Märtyrer für eine gerechtere Welt ist er Vorbild über seine Zeit hinaus.
Romeros Bekehrungs- und Entwicklungsprozess hatte seinen Kompass in der Kontemplation, in der betrachtenden Lektüre der Bibel, von Gaudium et spes, Populorum progressio, Evangelii nuntiandi und der Texte von Medellín und Puebla – aber auch in der Spiritualität des Ignatius von Loyola, der Teresa von Ávila und des Johannes vom Kreuz. Sein «neues Sehen» 1977 hat ihm geholfen, Christus in den Armen und Unterdrückten seines Landes zu entdecken – wie einst der Dominikaner-Bischof Las Casas im 16. Jahrhundert, als er in den geschundenen Indios gegeisselte Christusse sah, und einen Perspektivenwechsel bei seinen Zeitgenossen anmahnte, um die Ereignisse in der Neuen Welt so zu beurteilen, als wenn wir «Indios wären».
Oscar Romero entdeckte den ethisch-prophetischen Religionstyp, der vom Hunger und Durst nach Gerechtigkeit sowie vom Tun der Liebe geprägt ist, als Matrix des Christentums. Der Wiener Dogmatiker Jan-Heiner Tück bemerkte 2015 in der NZZ, dass Papst Franziskus mit der Seligsprechung Romeros als Märtyrer «die Semantik des Märtyrerbegriffs ins Politische verschoben hat». Tück schreibt, dass für die Gegner und Gegnerinnen dieser Seligsprechungen Romero nicht im Kampf für seinen Glauben, sondern für die Gerechtigkeit sein Leben verloren habe. Mit der Seligsprechung werde nun der Gerechtigkeitshass (odium iustititae) dem Glaubenshass (odium fidei) gleichgesetzt, da Romeros politisches Engagement für die Entrechteten und die Gerechtigkeit als Ausdruck seines Glaubens gewertet wurde: «Die sterile Trennung, die Kirche habe sich um das Heil der Seelen, die Politik um die Gestaltung der Welt zu kümmern, hat Oscar Romero nicht gelten lassen. Dadurch hat er dem Evangelium ein glaubwürdiges Gesicht gegeben. Als Märtyrer für eine gerechtere Welt ist er Vorbild über seine Zeit hinaus».
Prof. Dr. Dr. Dr. h. c. Mariano Delgado, Dekan