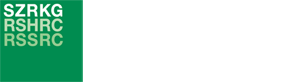Aktuelle Ausgabe
Volume 118 (2024)
THEMA - THÈME: Religion und postkoloniales Gedächtnis
-
Felicity Jensz | Films of Faith and Colonial Fantasy in Inter-War Germany
Filme des Glaubens und der kolonialen Phantasie – Postkoloniale religiöse
Erinnerungen im Deutschland der ZwischenkriegszeitNach dem ‹Verlust› der Kolonien am Ende des Ersten Weltkriegs nutzten die deutschen Missionsgesellschaften das Medium Film, um über die religiöse Arbeit auch in den ehemaligen deutschen Kolonien zu informieren. Zwischen 1927 und 1960 wurden über 65 Missionsfilme von katholischen und evangelischen Missionsgesellschaften produziert, viele davon mit einem ausdrücklichen Bezug zu den ehemaligen deutschen Kolonien. Das Medium Film ist bisher nicht daraufhin untersucht worden, wie es zur postkolonialen religiösen Erinnerungsarbeit beiträgt. Dieser Artikel konzentriert sich auf protestantische Missionsfilme und die sie begleitende Dokumentation, um zu zeigen, dass sie von ‹imperialer Nostalgie›/‹imperialistischer Nostalgie› (Lorcin/Rosaldo) und ‹kolonialer Nostalgie› (Lorcin) durchdrungen waren und von der populären kolonialen Revisionsbewegung als Referenz genutzt wurden, um moralische Ansprüche für die Rückgewinnung der Kolonien und die Rolle der deutschen Missionare geltend zu machen. In den kulturellen und politischen Turbulenzen der späten 1920er Jahre wurde die Verbindung zur politischen und religiösen Erinnerungsarbeit durch die Verwendung kolonialer und imperialistischer Nostalgie in Missionsfilmen verwischt.
Filme – Propaganda – protestantische Mission – postkoloniales Deutschland – Zwischenkriegszeit.
-
Daniel Annen | Reziproke Missionierung - Thomas Immoos
Reziproke Missionierung bei Thomas Immoos
Thomas Immoos war ein katholischer Priester, der das Gymnasium der Bethlehem-Brüder in Immensee besucht hatte und der später Mitglied dieser Missionsgesellschaft war. Geboren 1918 in Schwyz und dann aufgewachsen in Steinen, dürfte er also in seiner Kindheit und Jugend das beengende Normensystem des katholischen Milieus erlebt haben. Dies ist darum interessant, weil er in Japan und überhaupt in der grossen weiten Welt ganz andere Mentalitäten erlebte. Zu Beginn der Fünfzigerjahre nahm er eine Lehrtätigkeit in Japan auf, die er bis zu seinem Tod anno 2001 beibehielt, ab 1962 als Professor für deutschsprachige Literatur an der Universität Tokio. Allerdings unterbrach er seinen Japan-Aufenthalt hin und wieder, einerseits um 1961 beim berühmten Germanisten Emil Staiger an der Universität Zürich zu promovieren, anderseits ganz einfach, um seine nach wie vor geliebte heimatliche Innerschweiz zu besuchen. Müsste seine Innerschweizer Provenienz zusammen mit seinem katholischen Priestertum ihn nicht gedrängt haben, auch in Japan zugunsten seiner Herkunftskonfession zu missionieren? Das könnte man so erwarten, das war aber nicht so, nicht bei Thomas Immoos. Er blieb auch als Missionar in fremden Landen der Forscher, der Fragende. Statt eine Religion aufzuoktroyieren, suchte er nach dem Verbindenden zwischen der Religiosität in Japan und katholischen Positionen. Man kann also seine Missionierung als reziprok bezeichnen. Seine Forschungsschwerpunkte waren das japanische Kulttheater, der Shintoismus oder auch der Buddhismus, hier fand er Ähnlichkeiten und Analogien und in eins damit konnte er auf Defizite auch im Katholizismus aufmerksam machen. Hilfreich war ihm dabei C.G. Jungs Archetypenlehre. Ironischerweise, möchte man fast sagen, kann Thomas Immoos’ Blick in den fernen Osten neue psychologische und theologische Einsichten für den nahen Westen freilegen.
Milieukatholizismus – Normensystem – Analogien – Kulttheater – Shinto – Buddhismus – Reziprozität.
-
Fabio Rossinelli and Filiberto Ciaglia | The Collateral Activities of Missionaries in Southern Africa between Exploration and Exploitation
Erinnerungen in Spannung – Die Nebentätigkeiten von Missionaren im südlichen Afrika zwischen Erforschung und Ausbeutung im 19. Jahrhundert
Dieser Artikel analysiert die Aktivitäten mehrerer europäischer Missionare, die im 19. Jahrhundert in Lesotho, Sambia, Mosambik und Transvaal im Rahmen der Pariser Mission (Société des Missions Évangéliques de Paris, gegründet 1822) und der Lausanner Mission (Mission Romande, früher Mission Vaudoise, 1874) tätig waren. Der Schwerpunkt liegt dar-auf, wie diese Missionare ihre persönlichen Interessen ausserhalb ihres Mandats entwickelten. Dabei ging es um Wissen und Geld. Während einige Aktivitäten öffentlich gemacht wurden, wurden andere mit grösster Diskretion behandelt. Dies beeinflusste und prägte die Art und Weise, in der das Gedächtnis der Missionare sich konstruiert sah. Die für diese Studie verwendeten Quellen sind in einer Datenbank aufgeführt, die von den Missionaren selbst in Zusammenarbeit mit einem multidisziplinären Team in Italien erstellt wurde: missioniprotestanti-africaaustrale.org (online seit 2022, interaktiv ab 2024).
Mission – Südafrika – Wissen – Geld – Erinnerung – Gedächtnis.
-
Christian Antonio Rosso I Le memorie dei padri della Consolata e dei frati minori in Somalia
«Im Land der Aromen» – Geschichte des katholischen Missionsexperiments in Somalia im 20. Jahrhundert in den Erinnerungen der Consolata-Patres und Minderbrüder
Die Geschichte der katholischen Mission in Somalia ist eng mit den politischen Ereignissen der letzten italienischen Kolonie verknüpft, und zwar in enger Abhängigkeit von den Phasen, die der Kolonialismus in der Abfolge der liberalen und der faschistischen Ära, der britischen und der italienischen Verwaltung erlebt hat. In diesem Artikel soll versucht werden, anhand der Erinnerungen der Missionare die verschiedenen Phasen der missionarischen Expansion in Somalia kurz darzustellen, angefangen von den Pionierversuchen der Trinitarier, die 1904 begannen, bis hin zu den dauerhafteren Versuchen der Minderbrüder, nach der kurzen und bedeutenden Pause der Consolata-Patres. Die Memoiren, die in den Archiven aufbewahrt oder an die Presse weitergegeben wurden, zeigen deutlich das Bewusstsein, mit dem die Missionare «missionierten», die Beweggründe für ihr Handeln, die Verwirrung zwischen Zivilisation und Christianisierung. Sie bezeugen auch das Vorhandensein mehrerer «ideologischer» Produktionszentren: ein zentrales im Vatikan und ein eher peripheres, das zu Kompromissen mit dem Faschismus neigte. Die Rückkehr Italiens als Treuhandmacht an das Horn von Afrika im Jahr 1950 war für die Ordensleute Anlass, die Geschichte ihrer Präsenz in Somalia neu zu schreiben, nicht ohne Zweideutigkeiten, Auslassungen und Zurückhaltung.
Somalia – Consolata-Väter – Zivilisation – Christianisierung – missionarische Expansion – Erinnerungen.
-
Mick Feyaerts, Simon Nsielanga and Idesbald Goddeeris | Congolese Religious Memories of the Colonial and Missionary Past
Die Macht des Schweigens – Die Erinnerungen kongolesischer Ordensleute an die koloniale und missionarische Vergangenheit
Dieser Artikel untersucht, wie kongolesische Ordensleute – Jesuiten und Annonciades im Kongo und kongolesische Geistliche in Belgien – auf die koloniale Vergangenheit und die Rolle der Missionare zurückblicken. Es zeigt sich, dass sie sich dem meist positiv nähern, sogar mit Gratifikation und Lob, obwohl es auch vage Kritik und, in den 1970er Jahren im Kontext der Afrikanisierung, explizite Opposition gegen die herrschende Erzählung gibt. Das Verschweigen der dunklen Seiten der kolonialen Vergangenheit kann auf verschiedene Weisen erklärt werden. Zum einen überwinden kongolesische Ordensleute dadurch sowohl eine Lesart der kolonialen Geschichte des Kongo, in der Kongolesen lediglich Opfer sind und gewinnen zugleich die Kontrolle über ihre eigene Geschichte zurück. Zum anderen bestätigen damit auch ihre Zugehörigkeit zu ihren transnationalen Kongregationen und zur katholischen Kirche im Allgemeinen. Schliesslich sollte die Dominanz positiver Elemente in diesen kollektiven Kolonialerinnerungen auch vor dem Hintergrund des in-frastrukturellen Verfalls und der politischen Ohnmacht im heutigen Kongo betrachtet werden. Der Vergleich mit der Kolonialzeit erlaubt es den kongolesischen Religiösen, implizit eine Anklage gegen die Behörden zu erheben und sie gleichzeitig vor repressiven Massnahmen zu bewahren.
Missionare – Erinnerung – Dekolonisierung – Kongo – Belgien.
-
Silvia Cristofori | The Ibadan School and Historiographical Continuity as a Decolonisation of Africa's Past
Geschichte als lebendige Realität – Die Ibadan-Schule und historiographische Kontinuität als Dekolonisierung der afrikanischen Vergangenheit
Dieser Artikel analysiert einige Werke der Ibadan-Schule der Geschichtsschreibung mit dem Ziel zu zeigen, wie sie im Kontext afrikanischer Nationalismen dem afrikanischen Geschichtsbewusstsein eine historiographische Legitimation geben wollten. Dabei wurde zum einen deutlich, wie sehr die Geschichtsschreibung bis dahin nicht nur eine partielle Geschichte geschrieben hatte, sondern auch ein ideologisches Herrschaftsdispositiv war. Andererseits wurde versucht, eine historiografische Kontinuität sowohl mit den mündlichen Traditionen Afrikas als auch mit den von der christlichen nigerianischen Elite seit den 1870er Jahren verfassten nicht-akademischen Geschichtsbüchern herzustellen. Dieser Artikel wird aufzeigen, wie eines der interessantesten Vermächtnisse der Ibadan-Schule das ungelöste Problem war, dass die akademische und nicht-akademische Geschichtsschreibung zwar die afrikanische Vergangenheit mit einer universellen Geschichte verband und sie in ein Gespräch mit anderen menschlichen Erfahrungen brachte, aber auch die mündliche Tradition von dem Geschichtsgefühl trennte, das sie in ihrem eigenen Produktionskontext zum Ausdruck gebracht hatte.
Afrikanistische Geschichtsschreibung – Ibadan-Schule der Geschichtsschreibung – Dekolonisierung der Geschichte – Nationalismus und Geschichtsschreibung – Geschichtsschreibung der afrikanischen christlichen Elite im 19. Jahrhundert – afrikanische mündliche Traditionen und Geschichtsschreibung.
-
Francesca Badini | The Use of ‹Collective Memory› in Muhammad al-Gazali's Religious Discourse
Die Verwendung eines ‹kollektiven Gedächtnisses› im religiösen Diskurs von Muḥammad al-Ġazālī – die Schlacht von Badr (624) und der Oktoberkrieg (1973)
Ziel dieses Artikels ist es, die Möglichkeit auszuloten, das Konzept der retrospektiven Utopie in Muḥammad al-Ġazālīs (1917-1996) Predigt als Rekonstruktion des ‹kollektiven Gedächtnisses› zu analysieren. Die Analyse betrachtet die Predigt, die al-Ġazālī am 14. Dezember 1973 in der ʿAmr ibn al-ʿĀṣ-Moschee in Kairo über den Vers Q. 2:217 hielt. Die Analyse der betrachteten Predigt zeigt die exegetische Strategie, mit der es al-Ġazālī gelang, die Ereignisse im Zusammenhang mit dem Oktoberkrieg von 1973 zu rechtfertigen, d. h. den Angriff der ägyptischen Streitkräfte während des als heilig angesehenen Monats, der Schlacht von Badr im Jahr 624, ein Ereignis, das von der islamischen Tradition aufgearbeitet und der islamischen Gemeinschaft aus der Perspektive des ‹kollektiven Gedächtnisses› präsentiert wurde. In diesem Beitrag stelle ich die beiden betrachteten historischen Ereignisse vor, kontextualisiere al-Ġazālīs Predigttätigkeit im Jahr 1973 und weise auf die Beziehung zwischen dem Exegeten und der politischen Repräsentation des ägyptischen Staates in jenen Jahren hin. Anschließend analysiere ich die betrachtete Predigt und erkläre, warum der Autor sich dafür entschied, die Handlungen von Präsident Anwar Sadat (1918–1981) durch religiösen Proselytismus und durch den Rückgriff auf das ‹kollektive Gedächtnis› zu rechtfertigen.
Muḥammad al-Ġazālī – Oktoberkrieg 1973 – Schlacht von Badr – Islamische Gemeinschaft – Islamische Tradition – Ägyptischer Staat – Anwar Sadat.
-
Marcello Grifò | Memoria e missione nella riflessione teologica post-coloniale
Jenseits des Bösen die Martyrien der Erinnerung – Zu einer Geschichte der Kategorien Erinnerung und Mission in der postkolonialen theologischen Reflexion
Dieser Beitrag versucht, die dünnen Fäden des komplizierten Gewebes einer gequälten Geschichte neu zu verweben, und will nach einer Betrachtung des Umgangs mit dem Gedächtnis in Afrika während der Kolonialzeit – mal evokativ, mal substitutiv – dessen Funktion vor allem am Ende dieser umstrittenen Zeit untersuchen, als die Mission aufhörte, als einer der Hauptkanäle für die Verbreitung europäischer Werte und Lebensstile zu fungieren, und umgekehrt ein ernsthafter Prozess der Inkulturation des Glaubens aus theologischer, liturgischer und anthropologischer Sicht begann, sowie der Aufbau einer gerechten und modernen Gesellschaft, zu der die Kirchen ihren spezifischen Beitrag nicht versäumen wollten. Infolgedessen fällt die Kategorie der Mission nicht mehr mit dem Bemühen um die Verbreitung des christlichen Glaubens zusammen, sondern nimmt durch die Vermittlung einer Verkündigung des Evangeliums, die nicht mehr von einer genetischen Verbindung mit sozialer Gerechtigkeit, gerechter Umverteilung der Ressourcen, Demokratie und allgemeiner Versöhnung zu trennen ist, einen robusten zivilen Charakter an. Unter diesem Gesichtspunkt hat sich die vorliegende Studie dafür entschieden, unter den vielen möglichen Konjugationen der Gedächtnisbildung eine noch nie dagewesene theologische Deklination hervorzuheben, deren Erforschung noch immer zu den am wenigsten untersuchten in Geschichte und Anthropologie gehört. Sie geht über die Besonderheiten des endogenen Gedächtnisses hinaus und erhebt es zum Zeichen einer Universalität der Vernunft, die das Teilen von Grund- und Gründungsprinzipien und das Streben nach einem gemeinsamen Ziel für die Menschheit aller Religionen und Ethnien beinhaltet.
Martyria – Gedächtnis – Mission – postkoloniale Theologie – Inkulturation – europäisches Leben – soziale Gerechtigkeit – Universalität.
-
Ilaria Macconi | Inculturazione e ‹decolonizzazione› della missione in Africa
Inkulturation und ‹Entkolonialisierung› der Mission in Afrika –
für eine neue Erzählung der EvangelisierungIn meinem Beitrag möchte ich analysieren, wie sich in der Zeit unmittelbar nach den Prozessen der Entkolonialisierung in Afrika und auf Drängen des Zweiten Vatikanischen Konzils eine andere Erzählung über die Evangelisierung durchgesetzt hat und damit die Notwendigkeit, nach neuen Bezugsmodellen für die Begegnung mit dem Anderen zu suchen. In diesen Jahren des tiefgreifenden Wandels stellt die Kirche nicht nur die Zukunft der Mission in Frage, sondern auch ihre Vergangenheit. Im Mittelpunkt dieser «Revision» des missionarischen Gedächtnisses steht die Debatte über die komplexe Beziehung zwischen Glauben und Kultur, die auch zu einer Entkolonialisierung des Missionsbegriffs selbst führen wird. Die Erkenntnis, dass man ohne eine echte «Inkulturation» der Botschaft Christi nicht evangelisieren kann, setzt sich immer mehr durch. Anhand der Berichte über Konferenzen und Studienwochen lassen sich die wichtigsten Punkte der Diskussion nachvollziehen, während die Berichte der Missionare (vor allem aus Kenia) zeigen, wie sich dies im Alltag niedergeschlagen hat.
Afrika – Kultur – Dekolonisierung – Evangelisierung – Glaube – Inkulturation – Erinnerung – Mission – Missionare – Erzählung.
-
Madelief Feenstra | Postcolonial Memory at Work in Two Dutch Protestant Churches
«Es ist an der Zeit, voranzugehen» – Postkoloniales Gedächtnis am Werk
in zwei niederländischen protestantischen KirchenÄhnlich wie in anderen ehemaligen kolonialen Metropolen sind auch in den Niederlanden in den letzten Jahrzehnten bedeutende gesellschaftliche und akademische Debatten über das Wesen und das Erbe der kolonialen Vergangenheit des Landes, insbesondere der Sklaverei, aufgekommen. Immer mehr Institutionen – von Museen bis hin zu Stadtverwaltungen – haben in den letzten Jahren Programme zur Untersuchung und Anerkennung ‹ihrer› historischen Verstrickung mit dem transatlantischen Sklavenhandel lanciert oder sich auf andere Weise damit beschäftigt, wie Spuren dieser Vergangenheit die Gegenwart durchziehen. In diesem Artikel wird untersucht, wie zwei niederländische Kirchengemeinden, nämlich die Evangelisch-Lutherische Kirche Amsterdam und die Evangelische Brüdergemeinde Amsterdam Stadt und Flevoland, derzeit aktiv an diesem Wandel teilnehmen und sich mit der Geschichte und dem Erbe der Sklaverei auseinandersetzen. Dies geschieht durch die Analyse einer von beiden Gemeinden initiierten und 2020 erschienenen Publikation, die das Programm einer von beiden Gemeinden gemeinsam eingerichteten Arbeitsgruppe beschreibt und Texte eines Aufsatzwettbewerbs, eines Symposiums und von Predigten enthält.
Postkoloniale Erinnerung – Die Niederlande – Sklaverei – Religion – Mission – Surinam – Evangelisch-Lutherische Kirche – Mährische Kirche.
DOSSIER: FÖRDERUNG DER RELIGIONSFREIHEIT IM RAHMEN DES HELSINKI-PROZESSES
-
Eva Maurer | Das Schweizerische Ost-Institut, die Kirchen und die Menschenrechte
Wie hast Du’s mit der Religion? – Das Schweizerische Ost-Institut, die Kirchen und die Menschenrechte 1974–1975
In der Endphase der OSZE-Verhandlungen, 1974–1975, veröffentlichte das Schweizerische Ost-Institut (SOI) in Bern mehrere Texte über das Verhältnis von Religion und Kommunismus. Als antikommunistisches Forschungsinstitut nahm es zwar eine kritische Haltung gegenüber dem Verhandlungsprozess ein, bediente sich aber der in den 1970er Jahren populären Menschenrechtsrhetorik, um die Unterdrückung in den Ländern hinter dem Eisernen Vorhang anzuprangern. Dieser Fokus war jedoch nicht nur durch die kritische Situation der religiösen Praktizierenden in Osteuropa motiviert, sondern auch mit einer Kritik an ‹linken› Tendenzen innerhalb der Schweizer Kirchenorganisationen verbunden. Die Publikationen erschienen kurz vor kantonalen und nationalen Wahlen und wurden aus den Reihen der Zürcher FDP heimlich mitfinanziert. Ihr polemischer Stil stiess jedoch selbst in der politischen Mitte auf Ablehnung. Nach Mitte der 1970er Jahre scheint die Konzentration des Instituts auf religiöse Fragen nachgelassen zu haben, und im Gegensatz zum Institut Glaube in der Zweiten Welt (G2W) beschäftigte sich das Institut kaum mit den neuen Menschenrechtsgruppen in den sozialistischen Ländern.
KSZE-Prozess – Schweizerisches Ost-Institut – Peter Sager – Antikommunismus – Religion – Kirche – Menschenrechte – Osteuropa – Schweiz.
-
Erik Sidenvall | Missionary Enthusiasm and Human Rights Activism
Missionarischer Enthusiasmus und Menschenrechtsaktivismus – Eine Studie über die religionspolitische Welt der schwedischen Slawischen Mission, 1965–1985
In diesem Beitrag wird analysiert, in welcher Art und Weise sich die schwedische Slawische Mission (Slaviska missionen) von Mitte der 1960er-Jahre bis 1989 für Menschenrechte engagierte. Er legt dar, dass die Menschenrechtsarbeit, die sich in erster Linie auf die Lage der Protestanten in der Sowjetunion konzentrierte, zu einer Neudefinition ihres Öffentlichkeitsauftritts führte. In ihrer Eigenschaft und Rolle als Vorbotin des Wissens wurde sie zur Partnerin in einem lose organisierten Netzwerk von NGOs, die sich für die Förderung der Menschenrechte einsetzten.
Menschenrechte – Kalter Krieg – Protestantismus – Christliche Mission – Religion – Sowjetunion – Slawische Mission.
-
Markku Ruotsila | Finnish Churches and the Helsinki Process in Transnational Perspective
Entspannung, Finnlandisierung und Widerstand – Die finnischen Kirchen und der Helsinki-Prozess in transnationaler Perspektive
Dieser Artikel rekonstruiert das gesamte Meinungsspektrum der finnischen Kirchen zum Helsinki-Prozess anhand einer Reihe zeitgenössischer privater Korrespondenz und institutioneller Archive, der religiösen Presse und mündlicher Quellen. Er zeigt, dass der Helsinki-Prozess neben dem feierlichen offiziellen Diskurs, der sich auf Entspannung und Vertrauensbildung konzentrierte, in der gesamten finnischen Zivilgesellschaft, auch in den Kirchen, zu heftigen und langwierigen Auseinandersetzungen führte. Dies galt insbesondere für die Art der Menschenrechte, die nach Korb III der Schlussakte von Helsinki zu schützen sind. In dieser Frage trennte sich die ökumenisch gesinnte Führung der finnischen Kirche grundlegend von den evangelikalen Neo-Pietisten, die den Grossteil der aktiven Kirchenbesucher ausmachten. Wie ein Grossteil der übrigen ökumenischen Bewegung entschied sich die erstere für eine sozial fortschrittliche Agenda für die KSZE/OSZE, die eine Konvergenz der beiden konkurrierenden Wirtschaftssysteme anstrebte und die Religionsfreiheit zugunsten der ‹sozialen Menschenrechte› zurückstellte. Letztere wiederum lehnten Entspannung und Vertrauensbildung ab und interessierten sich für den Helsinki-Prozess nur als Mittel, um ihre eigenen Ziele der Religionsfreiheit in den von der Sowjetunion kontrollierten Ländern voranzubringen.
Ökumene – Evangelikalismus – Fundamentalismus – Menschenrechte – Finnlandisierung – Rollback – Bibelschmuggel – OSZE – KSZE.
-
Roland Cerny-Werner | Der Vatikan im internationalen Raum
Der Vatikan im internationalen Raum – Ein epistemologischer Turn zwischen Zweitem Weltkrieg und Zweitem Vatikanum
Zwar fühlte sich der Papst – seinem Selbstverständnis nach – schon immer für die ganze Welt zuständig, doch geschah dies bis in das 20. Jahrhundert hinein, mit einem eher exklusivistischem und supra-soziologischen Blick auf die «Die-Kirche-umgebende-Welt». Mit den dramatischen Herausforderungen des 20. Jahrhunderts jedoch, setzte eine theologische, politische und durchaus im foucaultschen Sinne zu verstehende epistemische Transformation ein. Ein Prozess, der anhand der päpstlichen Diplomatie im Fahrwasser des sich formierenden und fundierenden Kalten Krieges und der darin eingelagerten existenziellen Vernichtungsdrohung der ganzen Erde, gut nachvollzogen werden kann. Diese Neuorientierung fand ihren zwischenzeitlichen Höhepunkt mit der «Friedensrede» Paul VI. vor der UNO, hatte jedoch ihren Anfang schon in den Pontifikaten seiner direkten Vorgänger nach den beiden Weltkriegen genommen. So begann der Heilige Stuhl sein Engagement im Internationalen Raum zu konzeptualisieren und vor allem auch theologisch zu fundieren. Mit dem ekklesiologischen Turn des II. Vatikanums und der damit einhergehenden Absage an die Kirche als «societas perfecta», gewann der Papst deutliches Prestige in der internationalen Sphäre als authentischer Agent der «Bewahrung der Schöpfung».
Internationale Kirchenpolitik – Kalter Krieg – Vatikanische Ostpolitik – Diplomatiegeschichte – II. Vatikanisches Konzil – Friedensdiplomatie – Theologiegeschichte.
-
Katharina Kunter | Historical Perspectives on Churches and the New Geopolitical Challenges in Europe
Abschied von der Idee der Neutralität – Historische Perspektiven auf die Kirchen und die neuen geopolitischen Herausforderungen in Europa
Vor allem in den ersten beiden Jahren des russischen Angriffskrieges in der Ukraine beriefen sich zahlreiche ökumenische Kirchenvertreter auf die Instrumente der Entspannungspolitik der 1970er Jahre, um ihre gegenwärtigen kirchenpolitischen Positionen gegenüber dem Ukraine-Krieg zu legitimieren. Zentral waren dabei die Begriffe ‹Dialog› und ‹Neutralität›. Der Artikel untersucht, inwieweit sich weltweit einflussreiche christliche Einrichtungen wie der Vatikan, der Ökumenische Rat der Kirchen und andere religiöse Organisationen während des Kalten Krieges als neutrale Instanzen verstanden und darüber hinaus eine Selbstwahrnehmung pflegten, die mit dieser Haltung übereinstimmte. ‹Neu-tralität› wird dabei als historische Kategorie eingeführt und verwendet, indem die Rolle der Kirchen als vermeintlich neutrale Akteure sowie die Grenzen ihres politisch ‹neutralen› Engagements analysiert werden. Im Mittelpunkt stehen dabei die protestantischen Kirchen.
Kalter Krieg – Entspannungspolitik – Dialog – Neutralität – Ökumenischer Rat der Kirchen – Ukrainekrieg – 20. Jahrhundert – 1970er Jahre.
-
Massimo Faggioli | The Holy See's Appeals to Helsinki 1975 for Peace in Ukraine
«Wir brauchen einen neuen Geist von Helsinki» – Die Appelle des Heiligen Stuhls an Helsinki 1975 für den Frieden in der Ukraine in einer historischer Perspektive
Der Artikel analysiert die Beschwörungen des ‹Geistes von Helsinki› (die Helsinki-Vereinbarungen von 1975, an denen der Heilige Stuhl vollumfänglich beteiligt war) während der Bemühungen von Papst Franziskus und der vatikanischen Diplomatie, den Krieg in der Ukraine nach der von Russland am 24. Februar 2022 begonnenen Invasion zu beenden. Diese Beschwörungen wurden während des ersten Jahres des Krieges in der Ukraine wiederholt und zeigten die Distanz zwischen den Bestrebungen des Heiligen Stuhls und denen Russlands und der Ukraine, aber auch den Unterschied zwischen der vatikanischen Diplomatie und der ‹Ostpolitik› im Kontext des Kalten Krieges und in der Störung der internationalen Ordnung im 21. Jahrhundert.
Abkommen von Helsinki – Vatikan-Diplomatie – Kalter Krieg – Papsttum – Ostpolitik – Russland-Ukraine-Krieg.
VARIA
-
Stefan Bojowald | Eine kleine Beobachtung zur Lasterhaftigkeit der Mönche in der koptischen Vita Pachomii
Eine kleine Beobachtung zur Lasterhaftigkeit der Mönche
in der koptischen Vita PachomiiIn diesem Beitrag wird ein neuer Zugang zu einer Passage in der koptischen Vita Pachomii versucht. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Beschreibung des zügellosen Lebens einiger Mönche. Die Lust am Tragen schöner Kleider und andere weltliche Vergnügungen werden ausdrücklich kritisiert. Das gleiche Motiv lässt sich in der syrischen Apokalypse des Pseudo-Methodius ausmachen.
Koptische Patristik – Syrische Patristik – Kleidung – Vita Pachomii – Apokalypse des Pseudo-Methodius.
-
Paul Bühler-Hofstetter | Die Madonna in den Erdbeeren – Symbolik und Hintergründe
Die Madonna in den Erdbeeren – Symbolik und Hintergründe
Das Gemälde Madonna in den Erdbeeren zeichnet sich durch eine reiche Symbolik aus: Erdbeeren als Nahrung für verstorbene Kinder, ein Kind mit einem Tränenkrüglein für ein verstorbenes Kind. Es war wohl als Memorialbild für ein verstorbenes Kind gedacht. Eine Legende zum Tränenkrüglein will sagen, dass wir verstorbene Kinder Maria anvertrauen dürfen, die ihnen einen Zugang zum Paradies verschaffen will. Als Maler wird Hans von Tieffenthal aus Schlettstadt angenommen. Das Bild wurde 1865 durch den Kunstverein Solothurn aus dem dortigen ehemaligen St.-Josefs-Kloster erworben. Nach einer Flussbildlegende soll das Bild in der Reformationszeit (1528) die Aare heruntergeschwommen und frommen Schwestern anvertraut worden sein. Dass es in der Abtei Gottstatt stand, kann aus dem dortigen Marien-Patrozinium und der geografischen Nähe zu Solothurn geschlossen werden. Als Stifter kann Graf Konrad III. von Neuenburg in Frage kommen, der Pflegesohn der Witwe des letzten Nidauer-Grafen aus der Gründerdynastie von Gottstatt.
Kunstgeschichte – Symbolik – Memorialbild – Solothurn – Reformationszeit – Abtei Gottstatt.
-
Nicolas Giel | Deutsche Ideen in römischen Händen? – Eine komparative Analyse der De concordantia catholica von Nicolaus Cusanus und der Declamatio von Lorenzo Valla
Deutsche Ideen in römischen Händen? – Eine komparative Analyse der De concordantia catholica von Nicolaus Cusanus und der Declamatio von Lorenzo Valla
Mit einem Abstand von sieben Jahren setzten sich zuerst Nicolaus Cusanus und dann Lorenzo Valla mit der Frage auseinander, ob die Konstantinische Schenkung wahrheitsgetreu ist. Diese zeitliche Nähe hat die Frage aufgeworfen, ob Valla in seiner Widerlegung der Schenkung von Cusanus beeinflusst ist. Der folgende Artikel geht dieser Frage nach, um eine Antwort darauf zu finden. Hierzu werden sowohl die Argumente zur Widerlegung der Konstantinischen Schenkung als auch die Herrschaftsprogramme, die Cusanus und Valla in ihren beiden Werken, der De concordantia catholica respektive der De falso credita et ementita Constantini donatione präsentierten, miteinander verglichen. Durch den Vergleich wird deutlich, dass es genügend Argumente gibt, um von einer Anregung Vallas durch Cusanus auszugehen. Die beiden Texte weichen zugleich jedoch in mehreren essentiellen Punkten voneinander ab, weshalb es zu viel wäre, von einer Beeinflussung zu reden. Es ist deutlich zu erkennen, dass Cusanus in seiner politischen Ideologie den Kaiser begünstigt und Konzilien eine Sonderrolle zugesteht. Valla begünstigt hingegen die Stadt Rom und die Herrscher allgemein. Der Papst soll seine Primatstellung innerhalb der Kirche behalten.
Nicolaus Cusanus – De concordantia catholica – Lorenzo Valla – Declamatio – Politische Ideologie – Konstantinische Schenkung.
-
Mariano Delgado | Pioniere der Missionsutopie und der Missionsethnographie der Frühen Neuzeit – 1524 kamen die ersten zwölf Franziskaner nach Mexiko
Pioniere der Missionsutopie und der Missionsethnographie der Frühen Neuzeit – 1524 kamen die ersten zwölf Franziskaner nach Mexiko
Der Beitrag setzt sich mit Licht und Schatten der Franziskaner-Mission des 16. Jahrhunderts in Mexiko auseinander. Sie waren Pioniere der Missionsutopie mit der Neigung zur «Franziskanisierung» der Indios und Pioniere der Missionsethnographie in doppelter Absicht: zur besseren Ausrottung des Götzendienstes und zur Ehrenrettung der indianischen Kulturen. Nicht zuletzt aufgrund der Verquickung von kolonialer Eroberung und Evangelisation waren die Franziskaner nicht immer imstande, «den Fussspuren» ihres Vaters Sankt Franziskus zu folgen. Gleichwohl gehört ihre Mexiko-Mission alles in allem zu den glänzenden Kapiteln der Kirchengeschichte.
Mexiko-Mission – Franziskaner-Mission – Missionsutopie – Missionstehnographie.
-
Jan Nelis | Italian Fascism, Roman Antiquity and the Spectre of Racism
Christianisierung oder Sinisierung in der frühen Chinamission? Die Inkulturationsmethode Matteo Riccis SJ am Beispiel seiner auf Cicero referenzierenden Schrift De amicitia
Der Aufsatz untersucht in globalgeschichtlicher Perspektive die intrinsisch-inklusive Inkulturationsmethode Matteo Riccis (1552–1610) als einen Weg der Christianisierung, die die Kultur des chinesischen Kaiserreichs der ausgehenden Ming-Dynastie in ihrer Alterität zur europäischen ernst nahm. Mithilfe der humanistischen Deutung der Schrift Ciceros De amicitia gelang es Matteo Ricci in den Kommunikationsraum der literarisch gebildeten Mandarine so einzutreten, dass er den ethischen Gehalt dieser Schrift in mit ihr kompatible konfuzianische Wertvorstellungen ‹übersetzte›. Dabei wird gefragt, wie Ricci aufgrund seiner sprachlichen und interkulturellen Lernfähigkeit die kommunikative Anschlussfähigkeit des christlichen Wahrheitsanspruchs auf Heilsuniversalität in Transmissionsoperationen umzusetzen wusste, die bei einigen seiner Adressaten der meritokratischen Elite am Kaiserhof christianisierende Wirkungen im zeitgenössischen huma-nistischen Sinne erzielte. Die Ausgangsfrage nach dem Resultat dieser Operationen erledigt sich mithin: Christianisierung Chinas oder Sinisierung der christlichen Mission.
Marcus Tullius Cicero (106-43) – Matteo Ricci (1552–1610) – Chinesischer Kaiserhof der Ming – Konfuzianische Gelehrtenbeamte (Litterati) – Inkulturationsmethode – Sinisierung – Ritenstreit.
-
Zélian Waeckerlé | Une paroisse «franco-suisse» en diocèse de Bâle au XVIIIe siècle – regards transfrontaliers sur Rodersdorf et ses annexes de Liebenswiller et Biederthal (selon les sources locales)
Eine «französisch-schweizerische» Pfarrei in der Diözese Basel im 18. Jahrhundert – Grenzüberschreitende Blicke auf Rodersdorf und seine Nebengemeinden Liebenswiller und Biederthal (nach lokalen Quellen)
Hat eine Grenze im modernen und zeitgenössischen staatlichen Sinne des Wortes eine Kontrollbefugnis über das religiöse Leben der Gebiete und Bevölkerungsgruppen, die sie begrenzt? Die Gemeinden an der Grenze zum Jura im Elsass der Bourbonen liefern einige Antworten, die auf eine Porosität oder zumindest Relativität der staatlichen Grenze hindeuten. Dies gilt umso mehr, als sich die geistlichen Abgrenzungen nicht mit den zeitlichen Grenzsteinen überschneiden. So umfasste das Landkapitel Leimental sowohl Pfarreien, die zum Königreich Frankreich gehörten, als auch solche, die in den helvetischen Staaten lagen. Wegen ihrer beiden französischen Anhänge wurde die Pfarrei Rodersdorf von der lokalen Geschichtsschreibung als «internationale Pfarrei» bezeichnet. Auch wenn dieses Adjektiv theoretisch zutrifft, lässt die Tatsache, dass es zwischen Rodersdorf und seinen Anhängen praktisch keine soziokulturellen Brüche gibt, darauf schließen, dass diese Pfarrei umgekehrt in ein unklareres Gebiet – ein Land des Wissens – eingebettet ist. Eine «französisch-schweizerische» Pfarrei oder eine fiktive Grenze?
Königreich Frankreich – Helvetische Staaten – «Internationale Gemeinde» – Grenzgemeinde «Franco-Swiss» – Jura – Elsass.
-
Johan Smits | Towards a Contextual Canon of Theology – A Network-based Approach to German Academic Theology (1820–1870)
Auf dem Weg zu einem kontextuellen Kanon der Theologie – eine netzwerkbasierte Annäherung an die deutsche akademische Theologie (1820–1870)
Im Bereich der historischen Theologie ist die spätere Rezeption oft das Hauptkriterium für die Feststellung von Prominenz. Dieser Aufsatz zeigt, dass die verschiedenen Werkzeuge der Sozialen Netzwerkanalyse einen umfassenden Blick auf die theologische Landschaft ermöglichen, der die verschiedenen Kontextfaktoren und Entwicklungen einbeziehen kann. Nach einer Einführung in die angewandte Methodik wird die Bedeutung von Institutionen der Kirchenverwaltung und von Verbänden für die theologische Landschaft in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts untersucht. Es wird argumentiert, dass die Vereine vor dem Hintergrund einer weiterhin staatlich geprägten Kirchenverwaltungslandschaft so etwas wie eine nationale Bühne für akademische Theologen schufen. Der Artikel schliesst mit dem Versuch, einen netzwerkbasierten Kanon der Theologie für die Zeiträume 1820–1842 und 1843–1870 zu erstellen. Abschliessend werden die Implikationen dieses Kanons auf individueller und institutioneller Ebene kritisch diskutiert.
Soziale Netzwerkanalyse – Visualisierung – Akademische Theologie – Kirchenverwaltung – Gesellschaften – Kanon der Theologie – Theologiegeschichte.
-
Simon Friedli | Wie Der letzte Ketzer die Vergangenheit in die Gegenwart bringt
Wie Der letzte Ketzer die Vergangenheit in die Gegenwart bringt
Dieser Artikel analysiert den 2022 erschienenen Dokumentarfilm Der letzte Ketzer über den Entlebucher Bauer Jakob Schmidlin (1699–1747), welcher der Ketzerei beschuldigt, verurteilt und in Luzern hingerichtet wurde. Basierend auf Ansätzen zur historischen Film-analyse von Robert Rosenstone wird betrachtet, wie der Der letzte Ketzer sein historisches Thema in eine Erzählung formt, wie diese aufgebaut ist, in welcher Form und mit welchen stilistischen und audiovisuellen Techniken sie umgesetzt wird und welche Botschaften dem Publikum durch den Film schlussendlich vermittelt werden sollen.
Dokumentarfilm – Ketzerei – Schmidlin – Luzern – Alte Eidgenossenschaft – Filmanalyse – Populärgeschichte.
-
Ulrich van der Heyden | Das Prachtboot: Wie Deutsche die Kunstschätze der Südsee raubten – oder nicht
Das Prachtboot: Wie Deutsche die Kunstschätze der Südsee raubten – oder nicht
Im Verlaufe der seit etwa zwei Jahrzehnten in Europa, insbesondere beleuchtet an Hand der Entwicklungen in Deutschland, andauernden Debatten um die Rückgabe von angeblichem Beute- oder Raubgut aus den Ländern des Globalen Südens, vor allem aus den ehemaligen Kolonialgebieten, versuchen sich auch nicht nur wenige Geschichtskenntnisse besitzende Aktivisten, sondern auch Journalisten und sogar Wissenschaftler, deren Forschungsfelder eigentlich auf ganz anderen Forschungsfeldern liegen, zu beteiligen. Dazu gehört auch der wegen seiner Leistungen auf dem Gebiet der NS-Forschung sehr geachtete Historiker und Journalist Götz Aly. Er schrieb ein Buch über den angeblichen Raub eines Bootes aus der Südsee zur Zeit des deutschen Kolonialismus, welches grosse Aufmerksamkeit in den Medien erlangte – aber den Widerspruch und die Kritik der Fachexperten hervorrief.
Deutscher Kolonialismus – Restitution – Südsee – Wokeness – Kolonialgeschichte.