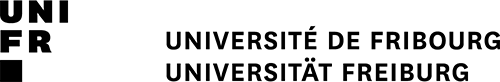Modul MAs02: Kursbeschriebe (2017/2018)
Mas02a: Zivilgesellschaft: Civil Society, Citizenship and Democracy
Moderne liberal-demokratische Gesellschaften sind durch ein Zusammenspiel der institutionellen Sphären von Markt, Staat und Zivilgesellschaft geprägt. In der Mitte des 20. Jahrhunderts lässt sich deren Verhältnis als ausgewogen, in einem gewissen Sinne als in einem Gleichgewicht befindlich charakterisieren, das im Wesentlichen durch die Institution der Citizenship (Staatsbürgerschaft) ermöglicht wird. Eine lebendige Zivilgesellschaft, in der Bürger sich staatsfern und nicht unter dem Einfluss von Marktimperativen vergemeinschaften und politisch aktiv sind, gilt seit Alexis de Tocqueville als Garant einer stabilen und demokratischen Gesellschaft.
Diese Vorstellung ist durch Globalisierung, Europäisierung und Transnationalisierung kaum aufrechtzuerhalten. Das Seminar widmet sich im Wesentlichen den Konsequenzen einer umfassenden Neoliberalisierung für die Demokratie und fragt nach Konsequenzen für die Institution der Citizenship wie auch der individuellen Citizenship rights (Bürgerrechte). Im Anschluss an eine umfassende Analyse dieser Konsequenzen geht das Seminar abschließend der Frage nach, inwiefern in Ländern, die als Folge der Bankenkrise unter ein hartes demokratisch nicht legitimiertes Austeritätsregime gezwungen wurden, neue Formen von Bürgerschaft im urbanen Raum als Form zivilgesellschaftlicher Aktion entstehen.
MAs02b: Gender und Sozialpolitik: Geschlecht und Gewalt als Thema staatlicher Politik
Gewalt gegen Frauen, lange Zeit als Privatproblem gefasst, gilt heute als soziales Problem und als Menschenrechtsverletzung, der Abbau geschlechtsbezogener Gewalt als staatliche Aufgabe und Verpflichtung. In den Resolutionen und Konventionen der Vereinten Nationen und der Europäischen Union verpflichten sich die Staaten, umfassende Maßnahmen zum Schutz und zur Unterstützung gewaltbetroffener Frauen und ihrer Kinder und zur Prävention der Gewalt einzuleiten (s. u.a. Council of Europe 2011, United Nations 2006). Auch sexuelle, psychische und physische Gewalt gegen Kinder und deren Prävention sind heute Thema menschenrechtlicher Vereinbarungen und staatlicher Sozialpolitik.
In dem Seminar sollen im ersten Seminarblock zunächst gesellschaftliche Diskurse und Entwicklungen aufgegriffen werden, die zu einer Skandalisierung und Politisierung von Gewalt im Geschlechter- und im Generationenverhältnis führten. Darauf aufbauend werden nationale und internationale empirische Studien zur Gewaltbetroffenheit von Frauen und Männern, Mädchen und Jungen untersucht und zudem Erkenntnisse zu Gewalt gegen besonders vulnerable Gruppen (u.a. Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderungen und Menschen, die heterosexuellen Normierungen nicht entsprechen) aufgegriffen. Daraus lassen sich Risikofaktoren und Ursachenzusammenhänge für gruppenspezifisch unterschiedliche Gewaltbetroffenheiten ableiten.
Der zweite Seminarblock befasst sich mit staatlichen Maßnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung der Gewalt. Thematisiert werden Strategien in Bezug auf veränderte Rechtsetzung und Intervention (Polizei, Justiz), verbesserte Unterstützung und Schutz für Gewaltbetroffene (support system), Täterarbeit und Täterprävention, der Rolle des Gesundheitssystems, mit Präventionsmaßnahmen in verschiedenen gesellschaftlichen Teilsystemen sowie der institutionenübergreifenden Vernetzung und Kooperation. Abschließend wird auf die Anforderungen eingegangen, die sich aus menschenrechtlichen Konventionen ergeben und die Notwendigkeit systematisierter langfristiger Datensammlungen und Monitoring auf nationaler und internationaler Ebene thematisiert.
MAs02c: Wirtschaft und Gesellschaft
Die Wirtschaft ist eine zentrale Säule der Gesellschaft. Von daher überrascht es nicht, dass sich die meisten Klassiker der Soziologie, insbesondere Karl Marx und Max Weber, auf ökonomischen Strukturen und Prozesen konzentriert haben. Im Unterschied zu den Wirtschaftswissenschaften wird dabei unterstellt, dass alle wirtschaftlichen Strukturen und Prozesse, sei das auf der sozialen Makro- oder Mikroebene, gesellschaftlich bedingt sind. Entsprechend stehen in der Wirtschaftssoziologie bis heute die Fragen, welche sozialen Voraussetzungen und Wirkungen wirtschaftliches Handeln hat, wie knappe Güter und Dienstleistungen produziert, konsumiert, verteilt und wie Märkte konstitutiert, koordiniert und reguliert werden, im Vordergrund. Nach einem Überblick über klassische Positionen (u.a. Adam Smith, Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber, Gustav Schmoller, Karl Polanyi) werden Kernkonzepte und -theorien der "neuen" Wirtschaftssoziologie (z.B. Institutionen, Embeddedness, Netzwerk, Vertrauen, Sozialkapital) thematisiert. Danach stehen aktuelle Fragestellungen im Vordergrund, z.B. Aufstieg des Neoliberalismus, Rekommodifierung, Transnationalisierung und Globalisierung, internationale und globale Einkommens- und Vermögensverteilung, Finanzialisierung
Die Studierenden kennen nach dem Besuch des Kurses die Grundlagen der soziologischen Analyse von wirtschaftlichen Strukturen und Prozesse und sind in der Lage sein, selbständig aktuelle Verflechtungen von Wirtschaft und Gesellschaft zu analysieren.
MAs02d: Vortragsreihe: Gibt es eine Erosion der Mitte der Gesellschaft?
Die Vortragsreihe geht der Frage nach, ob es eine Erosion der Mitte der Gesellschaft gibt und was diese allenfalls für die Betroffenen und die Gesellschaft zu bedeuten hat. Sie knüpft dabei an die internationale Debatte zunehmender Ungleichheiten an (Stichwort soziale Polarisierung) und ihrer sozialen, ökonomischen und politischen Auswirkungen an. Es wird immer wieder die Relevanz der Mittelschichten für die Stabilität der Gesellschaft, für die ökonomische Entwicklung und für die Demokratie hervorgehoben. Was passiert, wenn sich Verschiebungen in der Sozialstruktur ergeben, insbesondere in Ländern, die von einer grossen Mitte geprägt ist? In der Vortragsreihe sollen theoretische Konzepte der Mitte (Mittelklasse, Mittelstand oder Bevölkerung mit mittlerem Einkommen (middle-income groups)) und ihrer Funktionen und Relevanz aus unterschiedlicher Perspektive thematisiert werden. Dabei werden empirische Befunde und Zusammenhänge präsentiert und in nationale und internationale Zusammenhänge gesetzt. In welchen Regionen nimmt der Umfang der Mitte zu, in welchen stagniert sie, und in welchen nimmt sie ab? Solche quantitativen Aspekte werden durch qualitative Aspekte der Situation der Mitte ergänzt: was bleibt gleich, was ändert sich für die Mitte? Welche Erklärungsansätze gibt es für die Stabilität oder der Wandel qualitativer wie quantitativer Aspekte? Welche Konsequenzen haben sie für betroffene Bevölkerung, für die Politik, für die Arbeit, für die Gesellschaft insgesamt oder für die Demokratie? Ausgehend von Vorstellungen der Relevanz der Mittelschichten interessiert schliesslich inwiefern es Politiken und/oder Institutionen gibt, die die Mitte stützen, bzw. deren Erodierung entgegenwirken können.