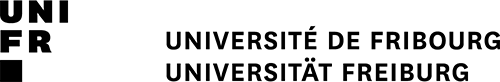Masterstudiengang „Geschichtsdidaktik und öffentliche Geschichtsvermittlung“
Modulübersicht, Kursangebote und Beschriebe, Universität Freiburg, Herbstsemester 2019 (Stand: 13.08.19, Änderungen vorbehalten)
Modul 4 „Zeitgeschichte“
MA-Vorlesung (Wissen und Forschung): Prof. ord. Dr. Siegfried Weichlein
Terrorismus: Politik, Organisation, Kommunikation
Mi 13-15 MIS 3027
Der Terrorismus hat eine lange Geschichte. Er will einen psychologischen Mehrwert durch Gewalt erreichen. Der Anarchismus des 19. und 20. Jahrhunderts mit seiner Parole der „propaganda dei fatti“, der Terror der RAF und der religiöse Terror unserer Tage wollen Gruppen, Gesellschaften und Staaten durch Terror in Schrecken versetzen und eine Handlungskette in Gang setzen, die alles verändert. Terrorismus ist eine Kommunikationsstrategie mittels Gewalt. Diese Master Vorlesung gibt einen Überblick über die Geschichte des Terrorismus und seiner Kommunikationsstrategien.
Einführende Literatur:
Peter Neumann, Der Terror ist unter uns: Dschihadismus und Radikalisierung in Europa. Berlin Ullstein 2016.
Michael Burleigh, Blood and rage. A cultural history of terrorism, London Harper 2009.
Cours MA (Wissen und Forschung): Prof. ord. Dr. Alain Clavien
Berlin, mémoires d’une ville
Mi 10-12 MIS 3028
Beschrieb folgt
MA-Seminar (Wissen und Forschung): Prof. ord. Dr. Damir Skenderovic
Neue Rechte: Wissenschaft, Kultur, Politik
Mi 15-17 MIS 2122B
In jüngster Zeit ist der Begriff der Neuen Rechten in den öffentlichen Diskussionen omnipräsent. Wenig Klarheit herrscht jedoch, was darunter zu verstehen ist und welche zeitgeschichtlichen Kontinuitäten bestehen. In dem Seminar werden wir zum einen die international geführten begrifflichen und definitorischen Diskussionen um die Neue Rechte aufnehmen. Zum anderen werden wir der Bedeutung der Neuen Rechten in verschiedenen Gesellschaftsbereichen, insbesondere in Wissenschaft, Kultur und Politik, seit den 1960er Jahren nachgehen. Ein Schwerpunkt wird auf Intellektuellen, Denkzirkeln, Publikationen und Verlagen in Frankreich, Deutschland und der Schweiz liegen.
Literatur
Tamir Bar-On, Rethinking the French New Right. Alternatives to Modernity, New York 2013.
Pierre-Andre Taguieff, Sur la nouvelle droite. Jalons d’une analyse critique, Paris 1994.
Volker Weiss, Die autoritäre Revolte. Die Neue Rechte und der Untergang des Abendlandes, Stuttgart 2017.
Modul 5 „Public History and Digital Humanities“
MA-Vorlesung (Public History): Prof. ord. Dr. Damir Skenderovic (Zeitgeschichte) und Prof. ord. Dr. Nicolas Hayoz (Politikwissenschaft)
Geschichtspolitik in West- und Osteuropa
Di 13-15 MIS 3027
In öffentlichen und politischen Diskussionen haben seit 1989 die Kontroversen um die Deutung und Funktion von Vergangenheit markant zugenommen. Verschiedene Akteure bedienen sich der Geschichte, um kollektive Repräsentationen anzurufen und politische Interessen zu verfolgen. So hat sich Geschichtspolitik als ein Teilbereich von Public History in unterschiedlichen politischen Systemen zu einem wichtigen Deutungs- und Handlungsfeld entwickelt, das Gesellschaften mobilisiert und Macht legitimiert. Jubiläen, Gedenktage, Geschichtsmuseen, Ausstellungen, Denkmäler und andere Erinnerungsorte dienen politischen Parteien, Medien und staatlichen Instanzen immer wieder als Anlass, um bestimmte Geschichtsbilder und Erinnerungsnarrative einzufordern und zu vermitteln. Auch für Historiker und Historikerinnen sind geschichtspolitische Debatten bedeutungsvoll, da sie als Produzenten von historischem Wissen wie auch als gesellschaftliche Deutungsakteure daran teilnehmen. In der Vorlesung werden wir verschiedene geschichtspolitische Auseinandersetzungen in West- und Osteuropa der letzten dreissig Jahre betrachten, insbesondere in Frankreich, Deutschland, Italien, Russland, Ungarn, Polen und der Schweiz.
Literatur
Bernhard Michael, Kubik Jan (Hg.), Twenty Years after Communism. The Politics of Memory and Commemoration, Oxford: Oxford University 2014.
François Etienne et al. (Hg.), Geschichtspolitik in Europa seit 1989. Deutschland, Frankreich und Polen im internationalen Vergleich, Göttingen: Wallstein 2013.
Schmid Harald, Vom publizistischen Kampfbegriff zum Forschungskonzept. Zur Historisierung der Kategorie „Geschichtspolitik“, Göttingen 2009: V & R unipress
MA-Seminar: Werkstatt (Public History): Dr. Andreas Schwab und MA Stefan Rindlisbacher
Besser leben! Eine Ausstellung über die Lebensreform
Di 10-12 MIS 3014
Immer wieder und vermehrt sind Historikerinnen und Historiker damit konfrontiert, ihre Forschungsresultate der Öffentlichkeit zu vermitteln. Historische Ausstellungen und andere Formen der Vermittlung historischer Sachverhalte wie Stadtrundgänge oder Vortragsreihen boomen und ziehen oft ein grosses Publikum an. Dieses Seminar bietet die Gelegenheit, einen Einblick in die Planung, Konzeption und praktische Gestaltung einer Ausstellung im Bernischen Historischen Museum zu erhalten. Vom 13. Februar bis 4. Juli 2020 werden die Resultate des historischen Forschungsprojekts „Die Lebensreformbewegung im 20. Jahrhundert“ (2014-2018) in der Ausstellung „Besser leben! Lebensreform bis heute“ präsentiert. Wie wurde das Projekt initiiert, geplant und finanziert? Welche Schritte müssen bei der Realisierung der Ausstellung beachtet werden? Neben diesen praktischen Fragen werden auch theoretische Zugänge, beispielsweise über die historische Entwicklung des Museums als Institution oder über die Bedeutung des (auratischen) Gegenstands in Ausstellungen behandelt. Ausserdem unterziehen wir die verschiedenen Möglichkeiten der museologischen Narration und der Interaktion mit dem Publikum einer kritischen Prüfung. Nicht zuletzt beschäftigen wir uns auch mit dem historischen Forschungsgegenstand der Ausstellung. Die Lebensreformbewegung prägte seit dem 19. Jahrhundert einige bis heute sehr populäre Gesundheitspraktiken wie Vegetarismus, Bio-Lebensmittel, Yoga, Meditation, Gymnastik und Komplementärmedizin. Wie lassen sich diese zum Teil sehr kontrovers diskutierten Themen einer breiten Öffentlichkeit vermitteln?
Modul 6 „Oral History, Visual History, Sound History”
MA-Seminar (Visual History): Dr. Patrick Kury
Am Beispiel des Schweizer Films
Mi 10-12 MIS 10-01.04
Es wird wieder vermehrt über Schweizer Geschichte gestritten: Dies zeigen die aktuellen Diskussionen zur Bewertung des Landesstreiks, zur Rolle von Robert Grimm als Streikführer und tragenden Figur der Sozialdemokratie sowie die erst vor Kurzen geführten Debatten zur Historisierung von Neutralität und der Bedeutung der Schlacht von Marignano für die Schweiz im internationalen Kontext. Bemerkenswerterweise sind nicht nur politisch-konservative Kräfte, sondern wieder vermehrt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an diesen Auseinandersetzungen beteiligt, die sich sowohl für historische Faktizität stark machen, wie auch um die Rückgewinnung von Deutungshoheit ringen. Die Lehrveranstaltung diskutiert Möglichkeiten und Grenzen der Visual History am Beispiel des schweizerischen Filmschaffens. Anhand ausgewählter Beispiele wird nach den wirkmächtigen Bildern und ihrer Bedeutung für die Erinnerungskultur der Schweiz gefragt. Im Mittelpunkt stehen einerseits Arbeiten aus der Zeit der „Geistigen Landesverteidigung“, die das visuelle Gedächtnis der Schweiz nachhaltig prägten und prägen, andererseits aktuelle Filme, die diese Bilder perpetuieren, bzw. konterkarieren.