Dossier
Deutschland, wie geht es dir?
Schlagzeile löst die andere ab. Im Gespräch mit drei Experten fühlen wir Deutschland den Puls.
Um den Tisch sitzen: Siegfried Weichlein, in Hessen geboren, hat in Freiburg im Breisgau, in Tübingen und in Jerusalem studiert, lange in Berlin gearbeitet und ist heute Professor für Europäische und Schweizerische Zeitgeschichte an der Universität Freiburg in der Schweiz. Damir Skenderovic, Professor für Zeitgeschichte, der seine ersten Lebensjahre in Dortmund verbracht hat, seinen Bezug zu Deutschland aber vor allem in seiner Forschung zur Geschichte des Rechtsextremismus und Rechtspopulismus nach 1945 sieht. Und Martin Rohde, der in Ostberlin geboren wurde und kurz nach dem Mauerfall für die Liebe in die Schweiz ausgewandert ist. Er hat Kunstgeschichte studiert, sich auf das Mittelalter spezialisiert und ist heute Geschäftsführer des Mediävistischen Instituts dieser Universität.
In Deutschland herrscht Krise oder wie in der Süddeutschen Zeitung zu lesen war: «Es gärt im Lande».
Wo gärt es denn im Moment am meisten?
Siegfried Weichlein: Krise ist Normalzustand. Es gibt keine Gesellschaften jenseits von Krise und die Krisenrhetorik ist sozusagen allgegenwärtig. Ich würde es eher eine Verdichtung von Problemen nennen, im Äusseren und im Inneren. Krieg in der Ukraine und im Gazastreifen. Ein anspruchsvolles Programm der Regierung zum Umbau der Industriegesellschaft, zum ökologischen Wandel, um den Klimawandel und die sozialen Schieflagen zu adressieren. Uneinigkeiten bei der Finanzierung und Umsetzung dieses Programms. Natürlich stösst das alles auf Widerstand.
Damir Skenderovic: Tatsächlich herrscht in Deutschland im Moment eine erhöhte Aufgeregtheit, die in einer bestimmten politischen Konfiguration stattfindet, aber zu sagen, es sei jetzt mehr Krise als gestern, dem würde ich widersprechen. Bei Krisen geht es ja auch um die Frage, wer definiert sie, wer füllt sie auf mit Deutungen und dann vor allem auch mit Lösungsangeboten. Das Interessante, das in Deutschland im Moment passiert, ist, dass in Bezug auf die Frage, wie die angebliche Krise überbrückt werden soll und mit welchen Lösungen, neue Player ins Spiel kommen und auch neue Lösungsvorschläge. Im politischen Raum gibt es nun «Alternativen», die in einer Krisendiskussion in den 90er Jahren nicht so realistisch erschienen, wie sie es jetzt sind.
Was sind das für Alternativen, die Sie ansprechen?
Damir Skenderovic: Es ist ein rechtes Lager, das auf den Plan tritt und zwar mit einem neuen, gestärkten Selbstbewusstsein. Obwohl diese Akteure und Denkwelten eine Geschichte im Nachkriegsdeutschland haben, wurden sie lange entweder belächelt oder ignoriert oder aber in Teile der CSU, der CDU oder auch in bestimmte Intellektuellenkreise integriert. Jetzt kommen sie in voller Montur in die Diskussion rein.
Profitieren diese Alternativen von einer gewissen Unsicherheit, von einer Unzufriedenheit in der deutschen Bevölkerung?
Damir Skenderovic: Das ist wie mit dem Huhn und dem Ei. Die Unsicherheit, ist sie da oder wird sie gemacht, evoziert? Ich glaube, es ist ein zentraler Punkt der gegenwärtigen Krisenwahrnehmung, dass gerade diese Akteure darauf aus sind, eine Rhetorik der Krise und Unsicherheit zu führen und damit Krisengefühle zu alimentieren.
Martin Rohde: Dem kann ich mich nur anschliessen. Ich denke, wenn wir von Krise reden, dann wäre es eine Krise auf einem sehr hohen Niveau. Natürlich gibt es auch Armut, Probleme und Frustration in Deutschland. Es ist ein Land, das einen einschneidenden Wandel erfahren hat. Aber solche Transformationsprozesse gibt es auch in anderen Ländern, die sind ja nicht auf Deutschland beschränkt. Es sind Prozesse, die zu grosser Verunsicherung führen können.
Vielleicht müsste man sagen, das Land ist in Aufruhr? Nichtsdestotrotz gehen ja seit Monaten tausende Menschen auf die Strassen und demonstrieren.
Siegfried Weichlein: Sozialwissenschaftler wie der Soziologe Steffen Mau von der Humboldt-Universität zu Berlin sagen uns, dass das Narrativ einer polarisierten Gesellschaft von urbanen, kosmopolitischen Eliten und abgehängten ländlichen Schichten, von Blue Collar gegen White Collar, von gut Ausgebildeten gegen schlecht Ausgebildete, nicht stimmt bzw. nicht verallgemeinerbar ist. Die Polarisierung wird eher bewirtschaftet. Natürlich steht in der Zeitung, es herrsche Krise. Aber ich will darauf hinaus, dass es gerade im akademischen Raum wichtig ist, einen nüchternen Blick zu behalten und sich nicht von der Tagespresse überwältigen zu lassen. So polarisiert und krisenhaft, wie viele tun, steht die Bundesrepublik nicht da.
Wie beurteilen sie die zunehmende Beliebtheit der Alternative für Deutschland – der AfD? Ist das ein Grund zur Sorge?
Siegfried Weichlein: Vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte ist natürlich jeder Prozentpunkt für diese Rechtsradikalen ein Grund zur Bestürzung und zum Protest. Und das hat sich in jüngster Zeit nochmal verdichtet dahin, dass die AfD sich selber radikalisiert hat. Historisch gesehen ist AfD nicht gleich AfD. Die haben angefangen mit Bernd Lucke, einem Ökonomie-Professor aus Hamburg. Der hat gegen den Euro gehetzt und wollte insbesondere europäische Dinge anders haben. Dann hat Frauke Petry aus Sachsen übernommen, eine Pastorenfrau. Mit ihr hat sich die Partei dann radikalisiert und das Migrationsthema ist allmählich stärker in den Vordergrund getreten. Mit der in Einsiedeln ansässigen Alice Weidel am Ruder hielt die Partei diesen Kurs bei. Dagegen stehen auf der anderen Seite der Partei Leute wie Alexander Gauland und natürlich SA-Leute wie Björn Höcke. Zwischen Höcke und dem braunen Milieu ist kein echter Unterschied mehr zu erkennen. So aufgeregt Frau Weidel auch tut, so tritt sie doch in erster Linie für niedrige Steuern, freie Unternehmerhand und ein libertäres Bild der Gesellschaft ein, das natürlich identitär bewirtschaftet wird, während Höcke ganz klar auf der völkischen Schiene fährt.
Damir Skenderovic: Ja, Alice Weidel ist nicht gleich Björn Höcke. Weidel ist die neue, modernisierte Verkörperung einer rechtspopulistischen Leaderfigur. Sie beherrscht das, was man auf Französisch einen double-discours nennt, rhetorisch geschult bespielt und alimentiert sie gleichzeitig rechtsextreme und eher gemässigte Tonlagen. Der Unterschied ist, dass Höcke es offen macht, er hat auch eine entsprechende Politisierung und Sozialisierung. Er kommt aus dem rechtsextremen, neonazistischen Milieu. Alice Weidel verbreitet das klassisch populistische Diktum «wir da unten gegen die da oben», also gegen eine angeblich korrumpierte Elite, die Deutschland zerstöre. Da ist Weidel gleich wie Höcke, und das ist das Gefährliche, da wird in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, die Demokratie erschüttert, weil man das Vertrauen in die demokratischen Institutionen und deren Umsetzung mit solchen Rhetoriken radikal untergräbt.
Sprechen wir kurz über Terminologie. Ist die AfD rechtsextrem, rechtspopulistisch – oder rechtsradikal? Was ist korrekt?
Siegfried Weichlein: Können wir uns darauf einigen, dass sie nicht wählbar ist?
Damir Skenderovic: Die AfD ist kein singuläres Beispiel in Europa. Es ist eine Partei, wie wir sie in vielen anderen europäischen Ländern beobachten – sie ist Teil des rechtspopulistischen Parteienlagers, das sich als Parteienfamilie in den 90er Jahren in Europa etabliert hat. Die AfD ist ähnlich wie der Front National – heute Rassemblement National –, der Vlaams Belang oder die skandinavischen Fortschrittsparteien, aber auch mit Unterschieden, die sie aufgrund der politischen Systeme, Institutionen und Geschichte der jeweiligen Länder aufweisen.
Martin Rohde: Obwohl sich ja zum Beispiel Le Pen von der AfD distanziert.
Damir Skenderovic: Die SVP distanziert sich auch von der AfD und lädt Alice Weidel nach Zürich zum Albisgüetli-Treffen ein …
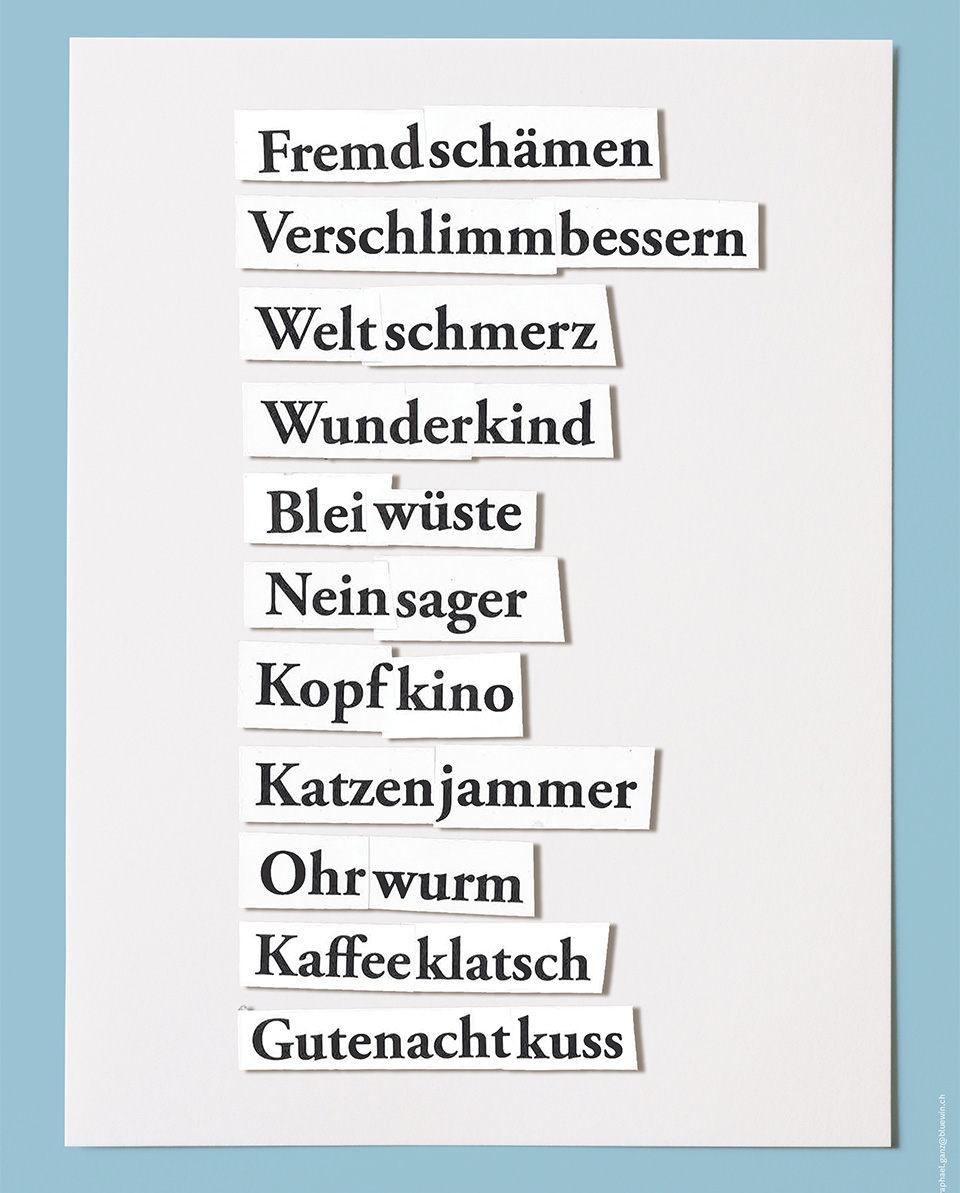
Auslöser für die Demonstrationen in Deutschland war ein Geheimtreffen von Rechtsradikalen im letzten November in Potsdam. Offenbar wurden da auch Pläne geschmiedet zur Aussiedlung von Millionen von Menschen in Deutschland. Wie ernst muss man solche Diskussionen nehmen?
Siegfried Weichlein: Da gefriert einem als Historiker schon das Blut in den Adern! Das ist der Vergleich zu den Nürnberger Rassegesetzen, in denen unterschieden wird zwischen Staatsbürgerschaft und Reichsbürgerschaft. Hier geht es nicht mehr um die Migrationsthematik. Hier ist die Neudefinition der bundesdeutschen Bevölkerung angesprochen. Deswegen ziehe ich auch den Begriff Bundesrepublik dem Begriff Deutschland vor. Es scheint mir wichtig von der Bundesrepublik zu reden und nicht diese identitär belastete Bezeichnung «Deutschland» zu gebrauchen. Worauf ich hinaus will ist, dass die AfD Deutsche mit deutschem Pass und mit deutscher Staatsbürgerschaft, mit deutschen Recht, mit deutscher Familie ausbürgern will. Und das ist unheimlich. Das hatten wir schon mal.
Damir Skenderovic: Also das Ereignis selber, das Treffen in Potsdam, das hat ja Kennerinnen und Kenner dieser Szene nicht überrascht. Aber das Ereignis ist wichtig, weil es eben ein Auslöser war für vieles, was jetzt gekommen ist mit den Demonstrationen, diesem öffentlichen Widerstand.
Die AfD gilt in den Bundesländern Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextrem. Wieso hat die Partei gerade in den neuen Bundesländern so viel Erfolg?
Martin Rohde: Es ist nicht eine reine Ostgeschichte, auch wenn es gerne als solche verkauft wird. Die gesamte Führungsriege der AfD ist aus dem Westen. Ausserdem hat die AfD mittlerweile auch in Baden-Württemberg oder in Hessen oder Bayern sehr grossen Zulauf, wenn auch nicht die gleichen Zahlen wie im Osten. Die Popularität der AfD im Osten hat sicher auch damit zu tun, dass es da noch immer ein grosses Potenzial an Unzufriedenheit gibt. Kein Wunder, wenn man daran denkt, dass es im Vergleich zum Westen immer noch einen Lohnunterschied von durchschnittlich 20 Prozent gibt, die Renten immer noch niedriger sind, die Industrie kaputt gegangen ist und so weiter.
Hätte man etwas anders machen müssen nach dem Mauerfall damit dieses Frustrationspotential nicht noch 35 Jahre nach der Wende so präsent ist?
Martin Rohde: Das wird ja mittlerweile auch gross diskutiert. Aus meiner Perspektive hängt es schon auch damit zusammen, dass in dem ganzen Prozess der Wiedervereinigung einiges schiefgelaufen ist, angefangen damit, dass man zum Beispiel die Verfassung, also das Grundgesetz, hätte erneuern müssen, so wie es im Grundgesetz selber ja steht. In Ostdeutschland gibt es immer noch viele Leute, die das Gefühl haben, sie seien Menschen zweiter Klasse in Deutschland. Das liegt vielleicht gar nicht mal nur dran, dass es ihnen schlechter geht, im Gegenteil, ich glaube vielen Leuten geht es besser als früher, aber man ist irgendwo immer ein Stück weit zurückgesetzt.
Siegfried Weichlein: Was auch eine Rolle spielt, ist, dass die Diktaturerfahrungen unterschiedlich sind. Die Diktaturerfahrung in Friedrichshagen, in Dresden oder in Rostock knüpft an bei der SED, der ehemaligen Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Das ist die letzte Diktatur, die sozusagen die Folie abgibt für den eigenen Protest. Und das ist auch der Grund, weshalb sich die CDU in Thüringen, Sachsen oder auch in Brandenburg so schwer damit tut, mit den Linken zu koalieren, um die AfD zu verhindern. Hinzu kommt noch der Umgang mit dem Nationalsozialismus im Zweiten Weltkrieg in der DDR. Der Holocaust und der Zweite Weltkrieg, das waren die anderen, das waren die Westdeutschen, das waren die Faschisten. Zusammengenommen gibt das eine ganz andere Konstellation als etwa in Düsseldorf, wo die letzte Diktaturerfahrung der Nationalsozialismus ist.
Damir Skenderovic: In den letzten Jahren stellt man sich in der Forschung vermehrt die Frage, inwieweit es fruchtbar ist, West- und Ostdeutschland miteinander zu vergleichen. Oder ob man nicht eher Ostdeutschland und andere osteuropäische Länder vergleichen sollte in dieser Zeit nach 1989. Und damit auch gewisse Entwicklungen, wie in den letzten 10 Jahren das Aufkommen nationalistischer, rechtspopulistischer Parteien in verschiedenen osteuropäischen Ländern. Ob hier nicht gesellschaftliche und politische Veränderungen stattfinden, die allgemein postkommunistische Regionen und Länder kennzeichnen.
Siegfried Weichlein: Vieles in der gegenwärtigen Diskussion läuft darauf zurück, dass die DDR bis 1990 fest verankert war im sozialistischen Wirtschaftssystem, im sozialistischen politischen System, auch im militärischen System, dann aber für die historische Analyse durch das Ereignis der Deutschen Einheit sozusagen automatisch hineingeschrieben wird in einen West-Ost Vergleich mit der Bundesrepublik. Wenn Sie die Transformation anschauen, also Transformationsforschung nach 1990, da ist die DDR gewissermassen Spitzenreiterin. Die Politiker früher in Bonn, dann in Berlin, führen immer wieder ins Feld, was «wir nicht alles getan haben». Sie haben dabei die Transformation in anderen Staaten im Blick. Die Menschen in Radebeul bei Dresden vergleichen sich aber nicht mit dem polnischen Wrocław, sondern mit Westberlin, Köln, Würzburg oder München. Transformationsgeschichtlich ist das gigantisch, was in den ostdeutschen Ländern geleistet wurde, die Wahrnehmung bildet das aber nicht ab.
Martin Rohde, Sie haben in der DDR gelebt. Können Sie verstehen, dass es so schwierig ist, aus diesen 28 Jahren hinter der Mauer in ein ganz anderes System katapultiert zu werden?
Martin Rohde: Das ist natürlich auch generationsabhängig. Für meine Generation kam die Wende genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich war 22. Die Welt stand auf einmal offen und wir hatten alle Möglichkeiten, die es vorher nicht gegeben hat. Für die Generation meiner Eltern war es natürlich eine Katastrophe, die sind schliesslich mit dem System gross geworden, meine Eltern waren überzeugte Kommunisten. Die haben das ganze System eigentlich mit aufgebaut, und für die war dann mit 50 auf einmal alles falsch, was sie in ihrem Leben gemacht haben.
Gemäss dem ehemaligen Ostbeauftragten Marco Wanderwitz ist die ehemalige DDR noch nicht in der Demokratie angekommen, jedenfalls nicht jene, die AfD wählen. Ist das eine zu krasse Aussage?
Siegfried Weichlein: Das ist zu krass! Man muss doch in Erinnerung rufen, dass sich nach 1990 schnell nicht nur Parteien ausgedehnt haben, sondern sich auch ostdeutsches Personal in Brandenburg, Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommern an die Spitze der Parteien gestellt hat. Und auch, dass Wahlen mit 70 bis über 80 Prozent eine enorm hohe Wahlbeteiligung erfahren, weit oberhalb der Schweiz. Die ostdeutschen Länder haben im Föderalismus eine Stimme; sie sind nicht zum Objekt von Almosen und Zahlungswilligkeit geworden, sondern zu einem politischen Subjekt auf Augenhöhe mit den alten Bundesländern. Die neuen Länder sind über den Bundesrat eingebunden in die Bundespolitik. Und vergessen sie nicht: Wir hatten 16 Jahre lang eine Bundeskanzlerin, die aus Ostdeutschland kommt.
Martin Rohde: Wir Ostdeutschen haben uns diese Demokratieerfahrung erkämpft! Ich war ja dafür sogar noch im Gefängnis vor dem Mauerfall. Da habe ich natürlich eine ganz andere Einstellung dazu, eben zum Beispiel zum Wählen. Für mich ist es unvorstellbar, dass man sein Wahlrecht nicht wahrnehmen kann. Und die Westdeutschen, die haben das sozusagen geschenkt bekommen. Deswegen finde ich es ein bisschen heikel zu sagen, die Ostdeutschen hätten da irgendwie keinen Zugang zur Demokratie.
Die Ost-West-Bezeichnungen halten sich hartnäckig.
Martin Rohde: Das kann man wohl sagen. Ich bin vor 30 Jahren ausgewandert und lebe jetzt länger in der Schweiz als damals in Ostdeutschland und bin hier eingebürgert. Aber ich bin häufig immer noch der Ossi. Das stört mich persönlich auch gar nicht. Stören tut mich aber der Umstand, dass der Begriff «Osten» noch immer pejorativ geprägt ist. Und über die Sprache kommt natürlich zum Ausdruck, dass der Osten noch immer nicht gleichberechtigter Teil der Bundesrepublik ist.
Zurück zur AfD. Diesen Herbst stehen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg Landtagswahlen an. Hat die AfD eine Chance?
Siegfried Weichlein: Gemäss den Umfragen gibt es einen enormen Anstieg der AfD, also auf bis zu 30 oder sogar über 30 Prozent. Die politisch-analytische Frage, die sich daraus ergibt, lautet: Sind die anderen Parteien in der Lage, eine Koalition bei allen Unterschieden unter sich zu bilden unter Ausschluss der grössten Partei, der AfD, oder schert eine der grossen Parteien, sprich die CDU, soweit aus und sagt «Nein, wir koalieren mit der AfD», und zwar mit dem Argument, das sei ja demokratisch. Das ist letztlich in allen drei Bundesländern die Situation, die ich sehe. Das Wachstum der AfD scheint mir analytisch also gar nicht so sehr im Zentrum zu stehen, sondern die Frage eben, wie sich die gemässigte Rechte verhält.
Martin Rohde: Im Moment sind die AfD-Zahlen wieder am Sinken. Aber es ist immer noch beschämend. Wobei dieses Stammpublikum an rechtsnationalistischen Wählern halt schon lange bei 20 Prozent liegt. Dass es darüber hinausgeht, also bis zu 30 Prozent, das gab es so noch nicht. Ich glaube aber nicht, dass es passieren wird, dass die CDU da irgendwo ausschert.
Siegfried Weichlein: Die Verabredung in der CDU scheint zu sein, dass man eine Koalition mit der AfD auf Bundesebene ausschliesst – und deswegen jetzt den Grünen Avancen macht. Auf Länderebene soll der Entscheid den Landesvertretungen überlassen bleiben.
Damir Skenderovic: Dieses Jahr ist ja ein Super-Wahljahr in vielen europäischen Ländern, aber auch ausserhalb Europas. Und die drei Wahlen in Deutschland sind ein Spiegelbild davon, was auch in anderen Ländern diskutiert wird beziehungsweise was diskutiert werden muss: Wie verhält man sich machtpolitisch wie auch demokratiepolitisch gegenüber Parteien, die Grundlagen der Demokratie unterminieren. Es ist bemerkenswert, dass man in Deutschland von einer «Brandmauer gegen rechts» spricht, während in anderen Ländern von einem «cordon sanitaire» gesprochen wird.
Siegfried Weichlein: Können wir bitte Bundesrepublik sagen und nicht Deutschland?
 Unser Experte Siegfried Weichlein ist Professor für Europäische und Schweizerische Zeitgeschichte am Departement für Zeitgeschichte.
Unser Experte Siegfried Weichlein ist Professor für Europäische und Schweizerische Zeitgeschichte am Departement für Zeitgeschichte.
siegfried.weichlein@unifr.ch
 Unser Experte Damir Skenderovic ist Professor für Zeitgeschichte am Departement für Zeitgeschichte.
Unser Experte Damir Skenderovic ist Professor für Zeitgeschichte am Departement für Zeitgeschichte.
damir.skenderovic@unifr.ch

 Unser Experte Martin Rohde ist Geschäftsführer des Mediävistischen Instituts.
Unser Experte Martin Rohde ist Geschäftsführer des Mediävistischen Instituts.