Dossier
Warum altern wir?
Ob es uns gefällt oder nicht: Zum Kreislauf des Lebens gehört die unausweichliche Tatsache, dass wir älter werden und irgendwann sterben.
In der Altsteinzeit lag die Lebenserwartung von uns Menschen bei der Geburt wohl nur zwischen 22 und 33 Jahren. Dank kontinuierlichen Verbesserungen in unserer Ernährung, Hygiene und Medizin hat sich die menschliche Lebenserwartung in den letzten 200 Jahren im globalen Durchschnitt mehr als verdoppelt; in der Schweiz liegt sie momentan bei ungefähr 81 Jahren bei Männern und 85 Jahren bei Frauen. Obwohl die Lebenserwartung also jedes Jahr ansteigt, altern wir aber dennoch – einfach später im Leben als noch vor einiger Zeit.
Aus biologischer Sicht bedeutet Alterung eine progressive Verschlechterung unseres physiologischen Zustandes mit zunehmendem Alter. Auf der Ebene der Population, zum Beispiel wenn wir einen bestimmten Geburtsjahrgang über die Zeit hinweg verfolgen, manifestiert sich dieser Prozess normalerweise als eine Zunahme der Mortalität und eine Abnahme der Fertilität. Das ist nicht nur beim Menschen so, sondern auch bei den meisten anderen Organismen, so etwa bei den Fruchtfliegen, die wir im Labor studieren.
Knacknuss der Evolutionsbiologie
Die Alterung stellt uns vor ein Rätsel. Zum einen haben wir einen höchst regulierten Aufbauprozess, dessen Raffiniertheit und Schönheit erstaunlich sind: Ein äusserst präzises Entwicklungsprogramm, welches von einer befruchteten Eizelle zu einem mehrzelligen Individuum von enormer Komplexität und biologischer Leistungsfähigkeit führt. Zum anderen haben wir den Zerfall der Körperfunktionen im Alter, welcher mit dem Tod endet. Wenn ein solch ausgeklügelter Aufbauprozess möglich ist, warum ist es dann nicht auch möglich, dass unserer Körper in einem ewig jungen, gesunden Zustand verbleibt? Lässt sich Alterung im Rahmen der Evolution plausibel erklären?
Evolution bedeutet, dass sich die Merkmale einer Population von Lebewesen über die Zeit hinweg verändern. Eine der wichtigsten Triebkräfte des evolutionären Prozesses ist die von Charles Darwin und Alfred Russell Wallace gemeinsam im Jahre 1858 beschriebene natürliche Selektion. Sie tritt dann in Erscheinung, wenn sich die Individuen innerhalb einer Population aufgrund von zufälligen erblichen Merkmalsunterschieden in ihren Überlebens- und Fortpflanzungsraten, d.h. ihrer «Darwinian fitness», unterscheiden. Wenn es solche Unterschiede gibt, dann führt die Selektion dazu, dass die Erbanlagen derjenigen Individuen, die eine höhere «Fitness» (und somit mehr Nachkommen) haben, in der nächsten Generation mit einem grösseren Anteil vertreten sind. Dieser dynamische Prozess bewirkt, dass Organismen bestmöglich an ihre Umwelt angepasst sind.
Im Lichte der Selektion und Anpassung betrachtet, stellt uns die Existenz der Alterung vor ein konzeptionelles Problem. Einerseits begünstigt die Selektion Individuen mit einer höheren Fitness und führt so zu ihrer optimalen Anpassung, andererseits aber ist die Alterung nachteilig für diese Fitness. Alterung bedeutet ja eine Abnahme des Überlebens- und Fortpflanzungserfolgs mit fortschreitendem Alter. Warum schafft es die ansonsten sehr wirkungsvolle evolutionäre Kraft der Selektion nicht, diesen Zerfall zu verhindern?
Blick in die Genetik
Über diese Frage haben sich schon die Gründungsväter der modernen Evolutionsbiologie den Kopf zerbrochen. Der englische Populationsgenetiker Ronald A. Fisher hat sich 1930 in seinem berühmten Buch «The Genetical Theory of Natural Selection», als einer der Ersten dazu Gedanken gemacht. Fisher realisierte, dass der «Reproduktionswert» – ein Mass dafür, wie viele Nachkommen die Individuen einer bestimmten Altersklasse in ihrer Zukunft wahrscheinlich noch bekommen werden – mit zunehmendem Alter der Individuen abnimmt. Anhand demographischer Daten von australischen Frauen aus dem Jahre 1911 rechnete er aus, dass der Reproduktionswert zunächst von der Geburt weg mit dem Alter ansteigt, bei ungefähr 19 Jahren ein Maximum erreicht, und dann stetig abnimmt, bis er bei etwa 50 Jahren auf null absinkt. Fischer erkannte, dass die Kurve des Reproduktionswertes über das Alter hinweg proportional zur «Stärke» der Selektion ist: Da der Wert nach der Geschlechtsreife absinkt, bis er Null erreicht, bedeutet dies, dass die Selektion mit zunehmendem Alter immer schwächer wirkt. Salopp gesagt: Ältere Individuen, die sich bereits erfolgreich fortgepflanzt haben und/oder keine Nachkommen mehr produzieren können, sind aus der Sicht der Selektion nichts mehr «wert».
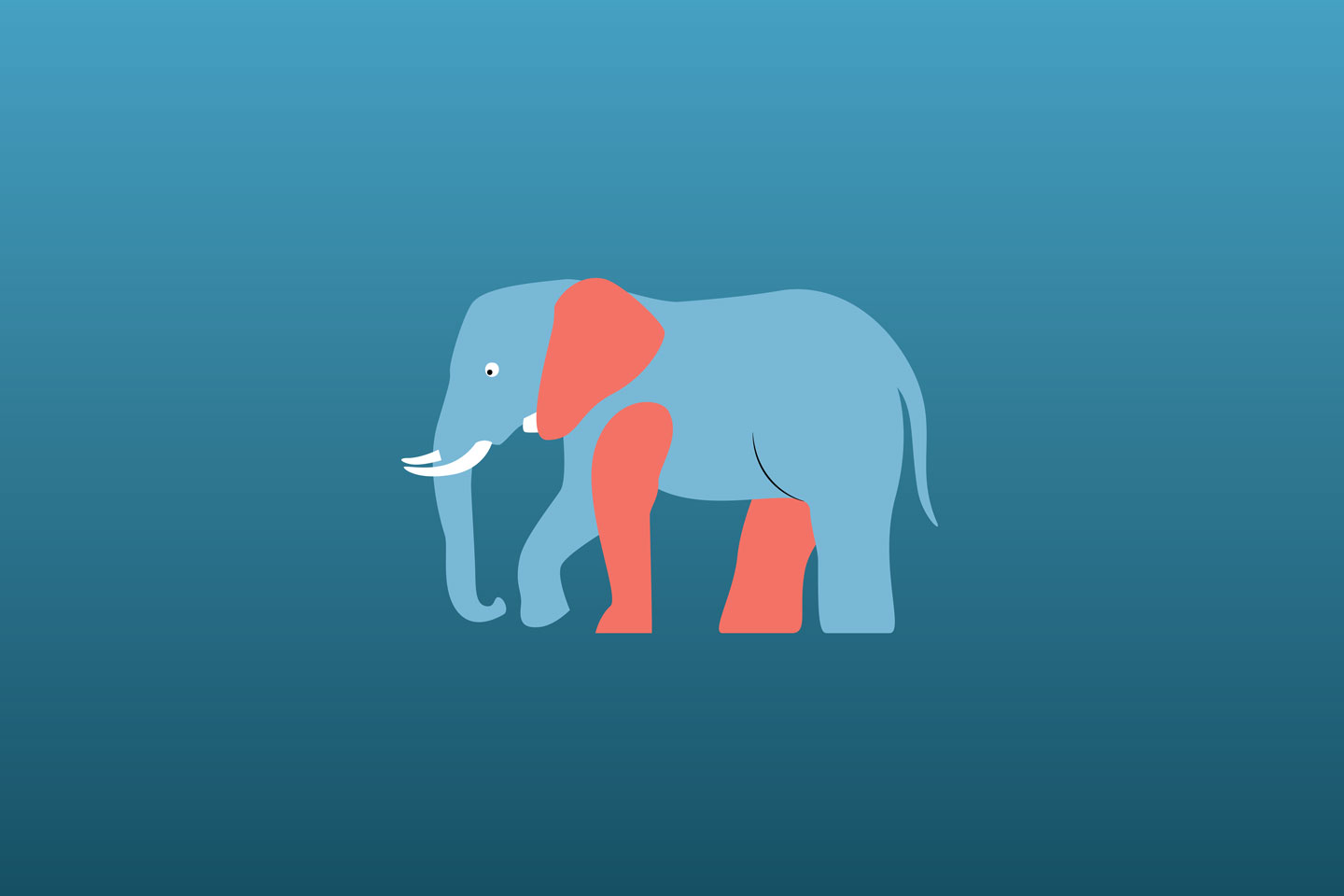
Was sind die Folgen davon? Wenn durch Zufall eine schädliche Mutation im Erbgut auftritt, deren negative Effekte sich erst spät im Alter manifestieren, wird die Selektion diese Mutation nicht effizient eliminieren können, da die Wirkung der Selektion zu schwach ist. Solche Mutationen können sich deshalb in der Population anhäufen. Diese Theorie der «Mutationsakkumulation» wurde, inspiriert durch Fishers Überlegungen, vom britischen Biologen und späteren Nobelpreisträger Peter B. Medawar 1946 entwickelt.
Der englische Universalgelehrte und Populationsgenetiker J. B. S. Haldane machte sich 1941 Gedanken in eine ähnliche Richtung: Vielleicht könnte die Abnahme der Selektionsstärke mit dem Alter ja erklären, warum die dominante Genvariante, welche die Huntington-Krankheit verursacht, so häufig in der Bevölkerung auftritt. Da die Huntington-Krankheit in der Regel erst jenseits des 30. Lebensjahres auftritt, wäre eine solche Krankheit in unseren kurzlebigen Vorfahren wohl nicht wirksam durch Selektion eliminiert worden. Die meisten Krankheitsträger wären bereits tot gewesen und/oder hätten bereits Nachkommen gezeugt, bevor sie Symptome dieser spät auftretenden Krankheit überhaupt hätten entwickeln können.
Wie kommt denn nun die Alterung ins Spiel? Stellen wir uns vor, dass wir von unseren wesentlich kürzer lebenden Vorfahren tatsächlich solche schädlichen Mutationen geerbt haben. Da sich unsere Lebensumstände, beispielweise verglichen mit dem Paläolithikum, im Laufe unserer evolutionären Geschichte massgeblich verbessert haben, überleben wir wesentlich besser und können auch mehr und länger Nachkommen produzieren, die ihrerseits sehr hohe Überlebens- und Fortpflanzungschancen haben. Die Kehrseite davon ist, dass wir nun lange genug leben, um die schädlichen Spätwirkungen der erwähnten Mutationen, unser «evolutionäres Erbe», zu spüren zu bekommen. Die Gültigkeit dieser evolutionären Theorie der Alterung, die später mathematisch von William D. Hamilton und Brian Charlesworth ausformuliert wurde, ist in ihren Grundzügen heute theoretisch wie auch experimentell gut belegt.
Meister des (Nicht-)Alterns
Dennoch gibt es sehr vieles, das wir noch nicht verstehen. Dazu gehört die faszinierende Frage, wie die grossen Unterschiede in der Schnelligkeit des Alterungsprozesses bei verschiedenen Arten zustande kommen. So wissen wir, dass manche Bäume Tausende von Jahren alt werden können. Auch der Grönlandhai, das langlebigste Wirbeltier, erreicht eine Lebensspanne von bis zu 400 Jahren. Zudem wurde festgestellt, dass bei Süsswasserpolypen (kleine Tiere, die mit den Quallen und anderen Nesseltieren verwandt sind) mit dem Alter weder die Mortalität zu- noch die Fertilität abnimmt. Und bei Nacktmullen, sozialen Nagern, die in Kolonien in unterirdischen Bauten in Ostafrika leben, nimmt die Mortalität mit dem Alter ebenfalls nicht zu. Das bedeutet, dass diese Arten per definitionem nicht altern – oder unmessbar langsam.
Dem Tod können Individuen solcher Arten dennoch nicht entgehen – irgendwann fallen sie einem Unfall oder einer Krankheit zum Opfer oder werden gefressen. Ihr Zustand aber verschlechtert sich mit dem Alter offenbar nicht. Die Stärke der Selektion nimmt also nicht bei allen Organismen mit dem Alter so schnell ab, wie Fisher es beim Menschen festgestellt hatte. Wie schaffen es diese Organismen, der Alterung zu entkommen? Die Süsswasserpolypen etwa haben viele Stammzellen, die sie zur Regeneration von beschädigten Zellen und Körperteilen einsetzen können. Nacktmulle haben einen Weg gefunden, mit dem Alter keinen Krebs zu bekommen. Wie diese Mechanismen aber im Detail funktionieren, ist noch wenig bekannt.
Solche Organismen verdienen daher mehr mechanistische Untersuchungen, da sie wichtige Erkenntnisse für die Regeneration und Reparatur und damit für unser Verständnis, wie ein langes Leben erreicht werden kann, liefern könnten. Ob uns solche Erkenntnisse dem von vielen Menschen ersehnten Jungbrunnen näherbringen werden und ob ein ewiges Leben überhaupt erstrebenswert und sinnvoll wäre, bleibe dahingestellt.
Unser Experte Thomas Flatt ist Professor für Evolutionsbiologie und Leiter des Departements für Biologie der Universität Freiburg. Er hat die im Naturhistorischen Museum Freiburg stattfindende Austellung «tick tack – der Countdown des Lebens» wissenschaftlich begleitet.
thomas.flatt@unifr.ch
