Interview
50 Jahre Frauenstimm- und Wahlrecht. Yeah?
Sollen wir uns ernsthaft über dieses Jubiläum freuen? Oder hätte die Geschichte anders geschrieben werden müssen? Ein Gespräch mit drei Expertinnen zeigt, wo der Hase im Pfeffer liegt.
Wie lässt sich erklären, dass es 1971 auch Frauen gab, die gegen das Wahl- und Stimmrecht für Frauen waren?
Pauline Milani: Es gab schon immer Frauen, die sich gegen das Frauenstimm- und Wahlrecht organisierten. Das fing schon in den 20er- und 30er-Jahren an, aber besonders auffällig waren sie in den 50ern. Es gab beispielsweise eine kleine, sehr aktive Frauengruppe in Bern und Zürich. Diese Frauen waren nicht zahlreich, dafür umso lauter, da sie sehr gut organisiert waren. Sie behaupteten, Politik zu machen, um das anderen Frauen zu ersparen. Sie sahen im Frauenstimmrecht keinen Mehrwert, weil sie einer relativ komfortablen Sozialschicht angehörten und mit wenigen diskussionswürdigen Problemen konfrontiert waren. Diese Frauen hatten alles, was sie brauchten und bewegten sich in konservativen Kreisen.
Eva Maria Belser: Es gibt immer Menschen, die grundsätzlich gegen eine Veränderung sind. Diese organisierten Frauengruppen waren Personen, die in einer Welt voller Stereotypen und Rollenbilder grossgeworden sind. Sie lebten bis 1988 alle unter einem Eherecht, in dem es noch hiess, dass der Mann das Oberhaupt der Familie sei. Verheiratete Frauen standen unter Vormundschaft. Das Konzept des gleichen Stimm- und Wahlrechts stand für viele Frauen völlig schräg zu ihrer gelebten Lebenswelt und stiess auf eine Gesellschaft und Rechtsordnung, die zutiefst ungleich war. Diese Ungleichheit zeigt heute noch Wirkungen.
Wie lassen sich denn diese Stereotypen bekämpfen?
Sylvie Durrer: Bereits Einstein sagte: «Es ist leichter, einen Atomkern zu spalten als ein Vorurteil.» Am besten lassen sich Stereotypen im Bildungsbereich bekämpfen, indem sie gar nicht erst geschaffen werden. Man sieht oft – und das belegen auch verschiedene Studien – dass Jungs Richtung körperliche und Platz fordernde Aktivitäten wie Fussball gedrängt werden, während Mädchen Gummitwist in einer Ecke des Schulhofs spielen sollen. Das Bildungspersonal soll sensibilisiert werden, um diese Stereotypen nicht zu reproduzieren. In diesem Bereich gibt es eine ganze Reihe von Massnahmen, die Mädchen dazu animieren, alle möglichen Berufe kennenzulernen und den Horizont zu erweitern, weil sie sonst nur eine bestimmte Auswahl an Jobs in Erwägung ziehen.
Zurück zu 1971. Nicht das Volk hat abgestimmt, sondern nur die Männer.
Eva Maria Belser: Diesbezüglich bin ich vor allem vom Bundesgericht enttäuscht; es hätte sich auf die Bundesverfassung berufen können, um das Frauenstimmrecht gerichtlich einzuführen. 1966 kamen die beiden UNO-Pakte zustande, die Schweiz hat sie erst 1992 ratifiziert. Es hätte sich auch auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte berufen können, die die Gleichberechtigung von Mann und Frau in ihrer Präambel bekräftigt und die Diskriminierung nach Geschlecht verbietet. Das Bundesgericht stellte sich auf den Standpunkt, das Männerrecht sei Teil des Gewohnheitsrechts, das Frauenstimmrecht könne deshalb nicht vom Gericht eingeführt werden. Es brauche dafür eine Verfassungsänderung – und also eine Volksabstimmung. Das war eine verquere Argumentation, denn eine Volksabstimmung konnte gar nicht stattfinden, sondern nur eine Männerabstimmung. Eine Frage auf die Demokratie zu schieben, wenn es gar keine Demokratie gab, war feige. In vielen anderen Staaten waren es die Gerichte, die das Frauenstimmrecht einfügten und damit klarstellten, dass der menschenrechtliche Anspruch auf Gleichberechtigung von Frau und Mann nicht vom Willen der Männer abhängen kann.
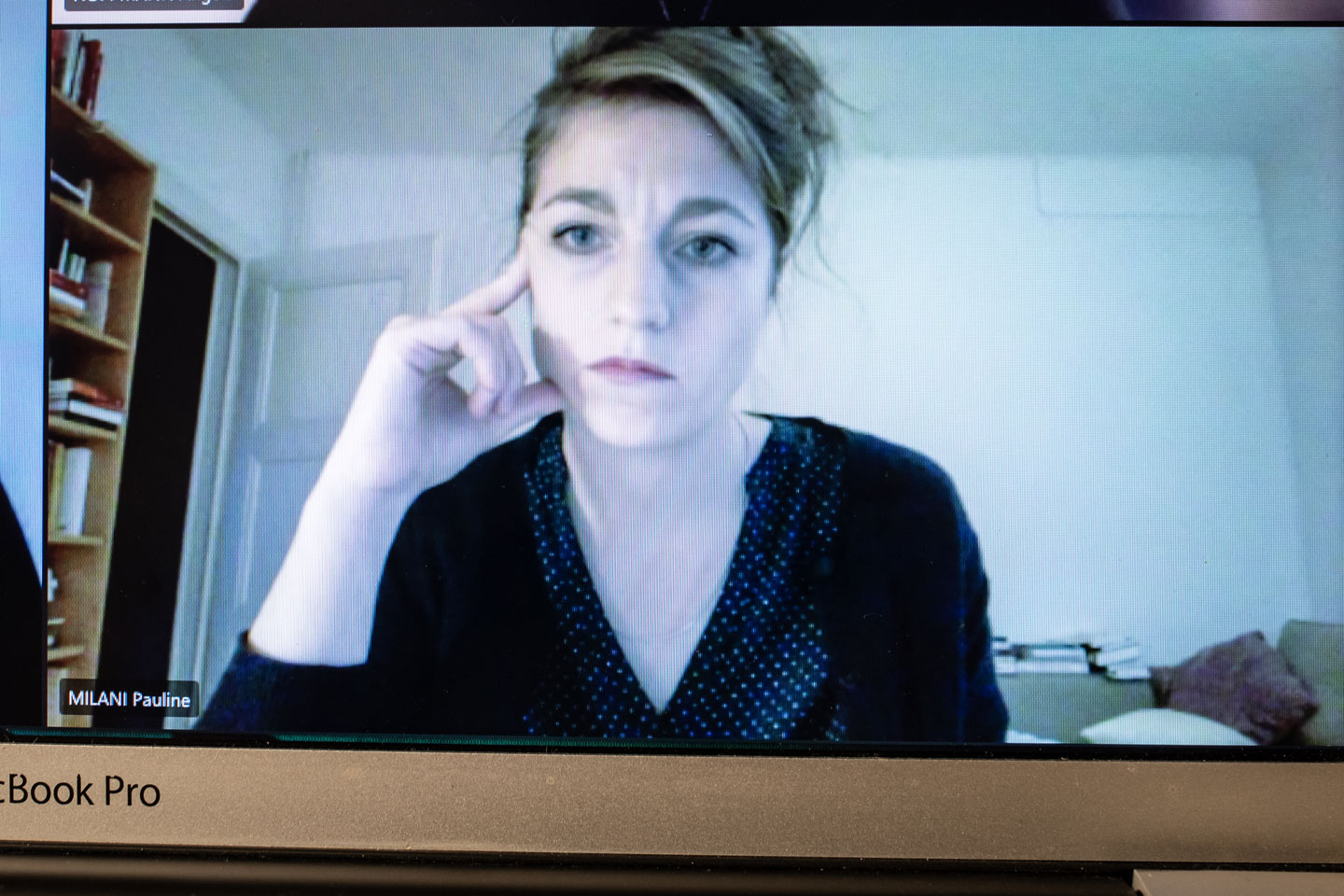
Pauline Milani ist Dozentin am Departement für Zeitgeschichte/Histoire contemporaine. Ihre Forschungs- und Lehrschwerpunkte sind Frauengeschichte und Geschlechtergeschichte im Europa des 19. und 20. Jahrhunderts.
pauline.milani@unifr.ch
Im 19. Jahrhundert wollte Emilie Kempin-Spyri als Anwältin tätig sein und durfte es nicht. Vor Gericht argumentierte sie, die Frauen seien in der Verfassung mitgemeint, wenn es «alle Schweizer» heisst. Ihre Klage wurde abgeschmettert.
Eva Maria Belser: Ich bringe diesen Fall im Unterricht immer als Beispielfall dafür, warum die allgemeine Rechtsgleichheit nicht genügt und es ein Antidiskriminierungsverbot braucht. Damals gab es nur den Rechtsgleichheitsgrundsatz «Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich», und dazu die berühmte Formel, dass «Gleiches nach Massgabe seiner Gleichheit gleich und Ungleiches nach Massgabe seiner Ungleichheit ungleich behandelt wird». Das heisst, es braucht einen sachlichen Grund, um rechtliche Unterscheidungen treffen zu können. Das Problem liegt darin, dass immer sachliche Gründe gefunden werden können, wenn eine Gesellschaft zutiefst ungleich ist. Das Bundesgericht kam zum Schluss, dass Frauen nicht gleich seien. Sie hätten kein Stimm- und Wahlrecht und weil sie nicht mitwirkten, wenn Gesetze geschaffen würden, könnten sie nicht glaubwürdig vor Gericht als Anwältinnen auftreten. Wenn eine Gesellschaft zutiefst ungleich ist, ist das ein Rad, das sich selbst dreht, Ungleichheiten aufnimmt, verrechtlicht und perpetuiert. Deshalb war es auch so ein grosser Schritt 1981, als das Diskriminierungsverbot eingeführt wurde. Erst ab diesem Zeitpunkt hielt die Bundesverfassung fest: Das Geschlecht ist kein sachlicher Grund, der eine Ungleichbehandlung rechtfertigt. Männer und Frauen sind gleichberechtigt – Punkt. Auch wenn es gesellschaftliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt, rechtlich sind sie gleich zu behandeln. Mehr noch: Der Gesetzgeber hat für die tatsächliche Gleichstellung zu sorgen und ist verpflichtet, gegen gesellschaftliche Benachteiligungen vorzugehen.
Pauline Milani: Völlig einverstanden. Die Schweizer Geschichte ist deshalb so interessant, da zur Zeit des Inkrafttretens der Bundesverfassung 1848 eine sehr starke Vorstellung natürlicher Differenzen zwischen Mann und Frau bestand, ganz unabhängig von Recht und Politik. Man dachte Geschlecht als etwas Binäres und Komplementäres. Jedes Geschlecht hatte eine eigene Sphäre: Die Frau am Herd, der Mann in der Öffentlichkeit. Diese Vorstellung geht sehr weit, so dass wir auch heute noch Überbleibsel davon spüren. Selbst die Feministinnen, die sich für das Frauenstimmrecht aussprachen, stützten sich auf die Geschlechtsdifferenzen: Weil Frau und Mann so unterschiedlich sind, können Frauen etwas Neues zur Schweizer Demokratie beitragen.
Stimmen Frauen anders ab als Männer?
Eva Maria Belser: Aus demokratischer Sicht spielt das zunächst keine Rolle. Es gilt «one person, one vote». Es gibt allerdings Untersuchungen, die durchaus belegen, dass es Unterschiede gibt, so wie es auch Unterschiede zwischen den Generationen gibt, zwischen dem sozialen Milieu, und bei gewissen Fragen eben nach dem Geschlecht. Ein Beispiel wäre die Konzernverantwortungsinitiative. Sie wäre angenommen worden, wenn es auf die jungen Frauen angekommen wäre.
Sylvie Durrer: Global betrachtet – und es hängt ein bisschen von den Abstimmungsthemen ab – neigen die Frauen dazu, etwas weniger abzustimmen. Das muss allerdings nach Altersgruppe untersucht werden. Die Abstimmung vom 29. November 2020 beispielsweise hat insbesondere junge Frauen mobilisiert. Bei den älteren Generationen waren es eher die Männer.
Pauline Milani: Dass alle Schweizerinnen bereits 1971 das aktive und passive Wahlrecht auf eidgenössischer Ebene besassen, machte es möglich, bestimmte Änderungen zu beschliessen, die nur Männer ablehnten. Die Frauen starteten sofort Initiativen zur Legalisierung der Abtreibung – die allerdings dann erst 2002 angenommen wurde – und zur Gleichberechtigung. Es waren ihre Stimmen, die 1985 den Unterschied machten, als das Ehegesetz revidiert wurde. Ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte der Frauenemanzipation. Nicht zuletzt, weil der Status des Familienoberhaupts abschafft und beiden Ehepartnern die gleiche Entscheidungsmacht über die Familie gewährt wurde. Diese Überarbeitung ist unerlässlich, ihr sollte viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Es wird viel von 1971 gesprochen, was natürlich sehr wichtig ist, aber einige Frauen in der Schweiz - das sollten wir nicht vergessen - hatten schon damals das Wahlrecht.
1958: Iris von Roten, als «Emanze der Schweiz» betitelt, veröffentlichte das kontrovers diskutierte Buch «Frauen im Laufgitter». Sie wurde von Männern und Frauen für die Ablehnung des Frauenstimmrechts 1959 verantwortlich gemacht. Müssten Frauen «braver» sein, um ihre feministischen Ziele zu erreichen?
Eva Maria Belser: Von Roten hat dasselbe Schicksal erlitten wie viele andere Frauen in diesem Kampf. Aber ich glaube nicht, dass man mit Zahmheit die Welt ändern kann und bin dankbar für jede Frau, die damals und heute auf den Tisch klopft. Es gibt keine Bewegung, wenn es nicht Menschen gibt, die sogenannte extreme Forderungen auf entschiedene Art und Weise stellen. Ich glaube nicht, dass die Frauen etwas erreicht hätten oder erreichen würden, wenn sie sich immer so verhalten würden, wie es den gesellschaftlichen Stereotypen entspricht. Es gibt auch viele wissenschaftliche Nachweise darüber, wie ungleich Frauen und Männer wahrgenommen werden. Ein Mann, der laut redet und Leute unterbricht, ist entschieden und zielstrebig. Eine Frau, die das gleiche tut, ist unangenehm, laut und vielleicht sogar unfähig. Wir müssen daran arbeiten, diese Wahrnehmung zu ändern. Man muss sich das mal vorstellen, es gibt sogar Stimmtrainings für Frauen, weil tiefere Stimmen offenbar besser ankommen. Das ist verrückt.
Ein entscheidender Faktor, etwas zu bewegen, war der UNESCO-Bericht von 1974 und der Wunsch, nicht rückständig zu wirken. Braucht es immer einen Reiz von aussen, um etwas in Bewegung zu setzen?
Eva Maria Belser: Zumindest in der Schweiz braucht es für Veränderungen offenbar immer beides: Druck von unten und von oben, aber eben auch von aussen. Napoleon und die napoleonischen Heere haben uns einen grossen Teil der Menschenrechte gebracht. Der Druck von Frankreich hat dazu geführt, dass die jüdischen Männer gleichgestellt worden sind in der Schweiz – freiwillig hätte man das offenbar nicht gemacht. Und beim Frauenstimmrecht war auch der Wunsch, der europäischen Menschenrechtskonvention beizutreten, gross. Jetzt ist es eigentlich immer noch so. Kommt jetzt die Schweizerische unabhängige Menschenrechtsinstitution? Es ist wahrscheinlich auch so, dass ein Land, in welchem bis 1971 die Androkratie derart aufs Podest gehoben wurde, unbedingt ein übergeordnetes, völkerrechtliches Korrektiv braucht. Die Idee von Grund- und Menschenrechten ist, dass man nicht über alles abstimmen kann: Sie gelten für alle, auch gegen den Willen der Mehrheit. Das ist eine Botschaft, die immer noch nicht richtig angekommen ist in diesem Land.
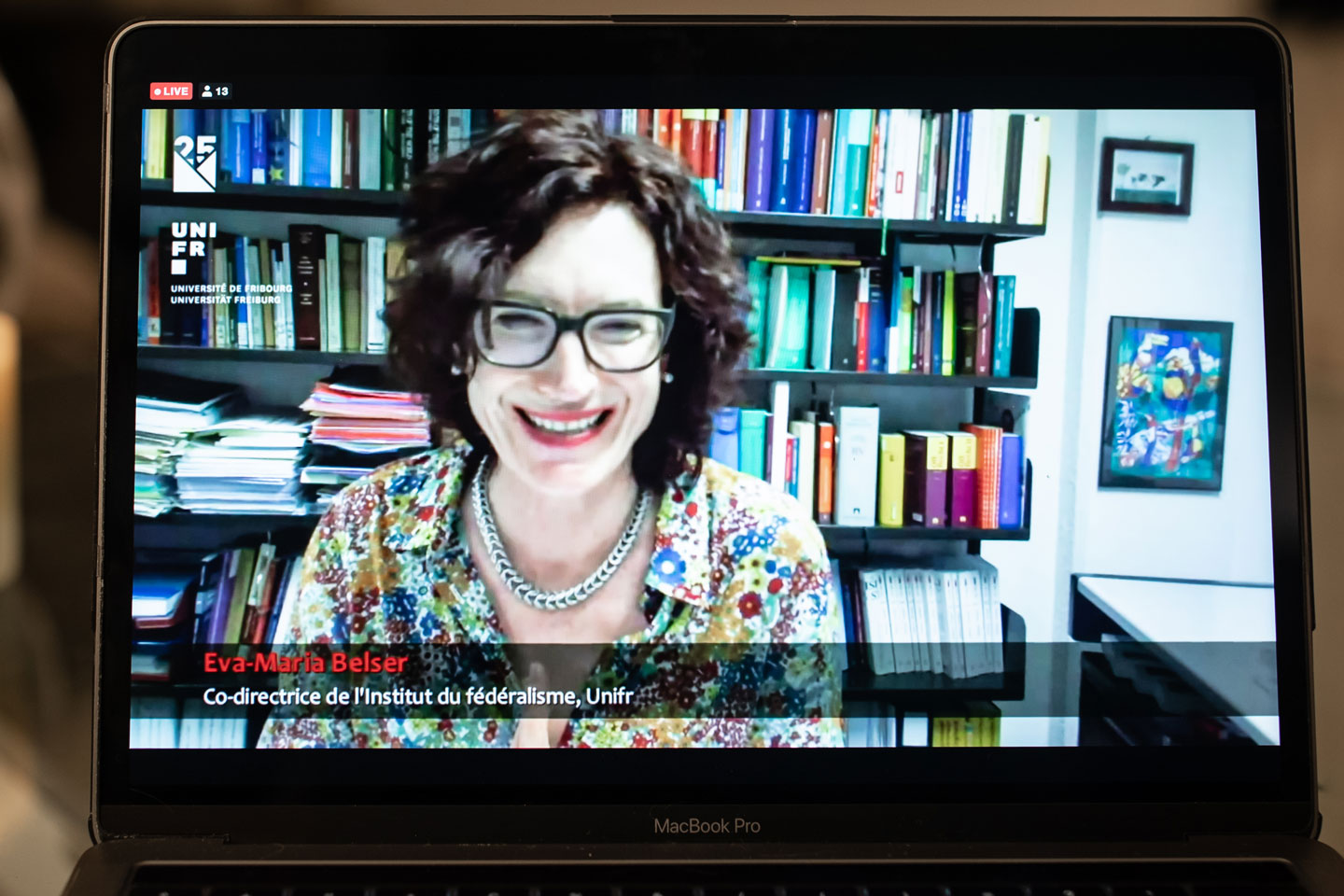
Eva Maria Belser ist Professorin für Staats- und Verwaltungsrecht und Co-Direktorin des Instituts für Föderalismus. Ihr besonderes Interesse gilt den Grund- und Menschenrechten, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit, dem Föderalismus sowie der Sozialstaatlichkeit in all ihren Ausprägungen.
evamaria.belser@unifr.ch
In der Schweiz geht es auch bezüglich Ehe für alle oder die Option eines dritten Geschlechtseintrages nur sehr schleppend voran. Wiederholt sich die Geschichte?
Eva Maria Belser: Es ist tatsächlich so, dass alle Staaten mit diesem Spannungsverhältnis umgehen müssen: Wo hat die Demokratie ihren Platz, wo kann die Mehrheit entscheiden? Wo brauchen wir die demokratische Legitimation und wo siegt die Rechtstaatlichkeit mit den Menschenrechten und dem Völkerrecht? Alle Staaten versuchen hier eine Balance zu finden und bei der Schweiz ist auffällig, dass das Pendel stark ausschlägt in Richtung Demokratie. Es entscheidet auch dort die Mehrheit, wo es um Rechte und Freiheiten Einzelner geht – das ist problematisch und gefährlich. Ende des 19. Jahrhunderts war die allererste erfolgreiche Initiative in der Schweiz die Einführung des Schächtverbots. Offiziell wurde sie mit Tierschutz begründet, aber das war zu der Zeit wirklich nicht das Thema. Die Initiative war, das ist heute unbestritten, antisemitisch motiviert. Die Mehrheit (damals nicht des Volkes, sondern der Männer) stimmte über die Religionsfreiheit einer Minderheit ab, wie wir das auch über hundert Jahre später mit dem Minarett-Verbot wieder gemacht haben und wie wir das in vielen anderen Bereichen weiterhin tun. Diese Meinung, dass die Mehrheit über die Rechte und Freiheiten von Minderheiten abstimmen kann, nähert die Demokratie manchmal gefährlich nah an eine Tyrannei der Mehrheit an. In unserem Land ist die Justiz enorm viel schwächer als in den umliegenden Ländern. Wir erachten Volksinitiativen selbst dann als gültig, wenn sie Menschenrechte verletzten, und wir haben keine volle Verfassungsgerichtsbarkeit: Das Bundesgericht muss ein Bundesgesetz selbst dann anwenden, wenn es die Verfassung, also etwa die Rechtsgleichheit oder das Diskriminierungsverbot, verletzt. Wir können deshalb das höherrangige Recht gar nicht immer durchsetzen, wenn die Mehrheit es anders will.
Es gibt auch Gesetze, die zwar neutral formuliert sind, aber diskriminierende Folgen haben können.
Eva Maria Belser: Das ist ein riesiges Problem. Wenn man etwa sagt, die ganze Fortpflanzungsmedizin sei nicht diskriminierend, weil alle, die verheiratet sind, Zugang haben zur heterologen Samenspende. Heiraten können aber nur heterosexuelle Paare. Das ist keine offene, aber eine indirekte Diskriminierung. Das Gesetz sieht zwar neutral aus, aber es wirkt sich nachteilig aus auf gleichgeschlechtliche Paare. Solche indirekten Diskriminierungen gibt es wohl noch viele in unserer Rechtsordnung. In der Teilzeitarbeit, bei der Schliessung der Schulen in der Pandemie … Das alles wirkt sich nicht auf beide Geschlechter gleich aus. Wir erleben jetzt gerade wieder, was indirekte Diskriminierung bedeutet.
Pauline Milani: Die Neutralität wird immer als «weisser Mann» gedacht, nie wirklich neutral. Wir haben seit 1971 eine etwas komplettere Demokratie, aber wir stimmen mehrmals im Jahr über Themen ab, die Ausländer_innen betreffen. Und die haben kein Stimm- und Wahlrecht, zumindest auf Bundesebene.
1988 wurde das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann gegründet. Was ist dessen Mission?
Sylvie Durrer: Die Mandate des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann wie auch jene der kantonalen Gleichstellungsbüros sind sehr vielfältig. Es geht um die Bekämpfung aller Formen von Diskriminierung, direkt und indirekt, und in allen Lebensbereichen. Das Büro hat unter anderem den Auftrag, die Bevölkerung zu informieren, an Rechtsprojekten teilzunehmen und Stellung zu Gesetzesentwürfen und parlamentarischen Geschäften zu nehmen. Wir unterstützen auch Projekte, welche die Chancengleichheit von Frauen und Männern im Berufsleben fördern. Seit diesem Jahr unterstützen wir neu auch Projekte im Bereich der Prävention von häuslicher Gewalt und Gewalt gegen Frauen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Förderung der Lohngleichheit, etwa mit der Entwicklung von Analyseinstrumenten wie dem international anerkannten Logib oder durch Kontrollen im Rahmen des öffentlichen Beschaffungswesens des Bundes.
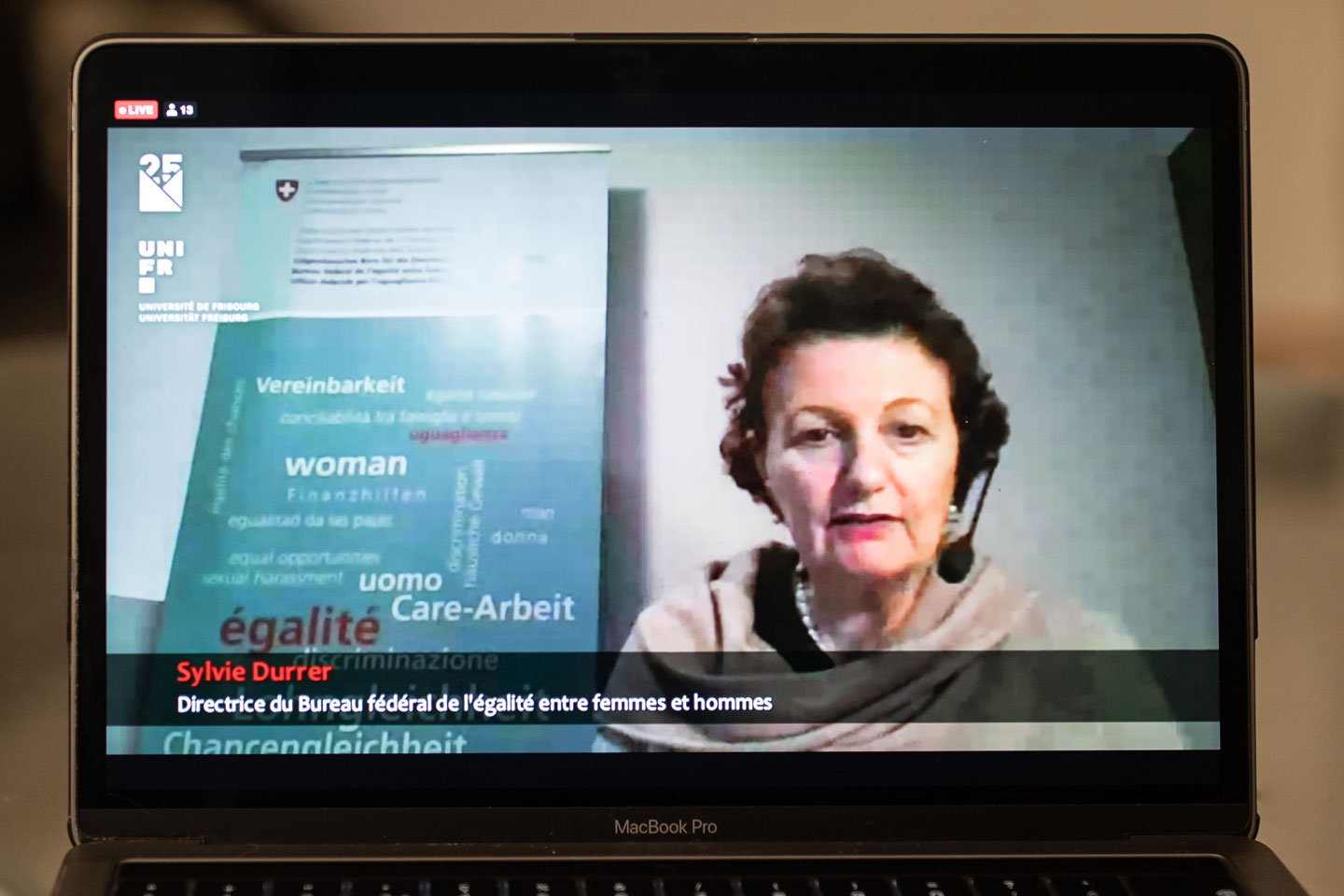
Sylvie Durrer ist seit 10 Jahren Direktorin des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann EBG, angesiedelt im Eidgenössischen Departement des Innern EDI. Unter ihrer Führung steigerte sich der Männeranteil im EBG auf 36 Prozent. Für sie bedeutet Gleichstellung mehr Wahlfreiheit – für Frauen und Männer.
sylvie.durrer@ebg.admin.ch
Sind die politischen Aufgaben und Forderungen, die wir öffentlich über die Gleichstellungsbüros wahrnehmen, nicht weitgehend cis, weiss, hetero und bürgerlich?
Eva Maria Belser: Nach meinem Dafürhalten ist das eine weitere Verspätung der Schweiz. In diesem Bereich gibt es wirklich wenig zu feiern, sondern vor allem viel zu betrauern, weil die Schweiz auch jetzt noch so ein schwarzes Loch ist wie damals vor 1971. Alle umliegenden Staaten haben allgemeine Antidiskriminierungsgesetze. Die Schweiz sieht sich mit dem äusseren Druck des Völkerrechts konfrontiert. Immer wieder wird die Empfehlung an die Schweiz gerichtet, ein allgemeines Antidiskriminierungsgesetz zu schaffen. Die offizielle Antwort der Schweiz lautet: «Wir brauchen das nicht. Wir haben den sogenannten sektoriellen oder fragmentierten Ansatz, haben die Gleichstellung von Mann und Frau, das Behindertengleichstellungsgesetz und Antirassismus-Stellen und das funktioniert super!» Das ist aber natürlich nicht der Fall, weil es ganz viele Diskriminierungskonstellationen gibt, die nicht abgedeckt sind. Wir haben auch keine Institutionen, die gut mit Mehrfachdiskriminierungen umgehen können. Das Thema ist wichtig, wird aber immer wieder schubladisiert. Die jetzigen Institutionen haben ihren Zweck, ihre Bedeutung, sie sind historisch gewachsen und haben wichtige Aufgaben zu erfüllen. Aber es kommen neue hinzu und diesen sollten wir uns auch annehmen. Wir haben gravierende Lücken in unserem Gleichstellungsrecht, auch im Bereich der Benachteiligungen, die nicht vom Staat, sondern Privaten ausgehen.
Pauline Milani: Ich würde gerne das Gleichstellungsreglement der Uni Freiburg an dieser Stelle erwähnen. Das Konzept ist sehr «90er». So ist das Ziel bisher, gleich viele Männer wie Frauen auf bestimmten Posten zu haben. Kein Wort über Diversität, über verschiedene Arten der Ungleichheit an der Uni … Meines Wissens ist eine Revision im Gange, aber wir sind im Jahr 2021!
Immerhin haben Schweizer Unis im Gegensatz zu anderen Ländern Frauen sehr früh zum Studium zugelassen.
Pauline Milani: Auch dort muss man nuancieren. Universitäten öffneten sich zwar sehr früh für die Frauen, aber um angenommen zu werden, musste man einen Matura-Abschluss haben. Als die Uni Freiburg 1907 die ersten Frauen zuliess, gab es für sie in Freiburg noch keine Möglichkeiten eines Maturaabschlusses. Es waren also vor allem Studentinnen aus dem Ausland, die Zugang hatten. Seit den 1970er Jahren steigt die Zahl der Studentinnen stetig an, heute machen sie fast 60 Prozent der Studierenden in Freiburg aus, doch die Zahl der Professorinnen stagniert immer noch bei etwa 25 Prozent. Es gibt noch viel zu tun.
Anm. d. Red: Sylvie Durrer konnte beim Interview nicht anwesend sein. Ihre Aussagen wurden mit ihrem Einverständnis dem Wissenschaftscafé «Frauen – 50 Jahre Wahlrecht und dann?» vom 27. Januar 2021 entnommen.
