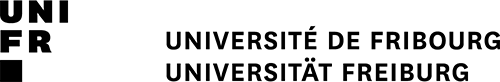Theologie der Spiritualität. Spiritualität. Hauptvorlesung
UE-TTH.00344
| Dozenten-innen: Delgado Casado Mariano, Emmenegger Gregor, Hoffmann Veronika, Klöckener Martin, Loiero Salvatore, Negel Joachim, Rutishauser Christian, Schmid Hansjörg, Schumacher Thomas, Zander Helmut |
| Kursus: Master |
| Art der Unterrichtseinheit: Vorlesung |
| ECTS: 3 |
| Sprache-n: Deutsch |
| Semester: HS-2019 |
Die Ringvorlesung versteht sich als interdiziplinäre Reflexion der Bedeutung von Spiritualität für Religionen, Kirchen und Gesellschaften in Geschichte und Gegenwart, mit folgendem Aufbau und Inhalten:
18.09.2019: Theologie der Spiritualität / Dozent : Negel, Joachim
Inhalte: Das Wort „Spiritualität“ hat Konjunktur; „spirituell sein“ assoziiert Nachdenklichkeit, Einfühlungsvermögen, Aufmerksamkeit, Sensibilität. Man kann sehr gut ein spiritueller Mensch sein, ohne deswegen Christ sein zu müssen. Gleichwohl stammen viele der in den derzeitigen Spiritualitätsdiskursen verwendeten Begriffe aus christlichen Traditionszusammenhängen. Diesen Verflechtungen und Abstoßungen soll in der Vorlesung nachgegangen werden. Dabei wird deutlich werden, dass es dem oft beklagten Erfahrungsdefizit christlicher Religionspraxis und der sie reflektierenden Theologie geschuldet ist, wenn „Spiritualität“ derzeit so sehr en vogue ist.
25.09.2019: Die Heilige Schrift zwischen historischer Kritik und geistlicher Betrachtung / Dozent: Schumacher, Thomas
Inhalte: Über viele Jahrhunderte hinweg waren Bibellektüre und geistliches Leben eng miteinander verbunden. Ein beredtes Zeugnis dafür ist gewiss die hermeneutische Konzeption des mehrfachen Schriftsinns, der letztlich darauf abzielt, die biblischen Texte in die eigenen Lebensvollzüge hinein zu applizieren. Mit dem Grundanliegen der Renaissance, welches sich in dem Schlagwort „ad fontes“ sprachlich auf den Punkt bringen lässt, etabliert sich jedoch ein neuer Umgang mit der Bibel, der letztlich dazu führt, dass einerseits die Schriftlektüre auf eine als „Literalsinn“ zu bezeichnende Perspektive reduziert wird, während sich andererseits die spirituelle Dimension von ihrer biblischen Rückbindung ablöst. Die Vorlesung versucht diese geistesgeschichtlichen Implikationen und Konsequenzen für die Bedeutung der Heiligen Schrift im Bereich der Spiritualität nachzuzeichnen, möchte zugleich aber auch vor einem allzu funktionalistischen Umgang mit den biblischen Texten warnen. Denn letztlich sind diese selbst bereits Niederschlag eines geistlichen Reflexionsprozesses und deshalb als herausragende Zeugnisse spiritueller Literatur zu würdigen.
02.10.2019: Antike / Dozent: Emmenegger, Gregor
Inhalte: Das antike Christentum kennt keinen einheitlichen Begriff für eine geistliche Glaubenspraxis. Im Zentrum des Lebensvollzuges steht die persönliche Nachfolge Christi, welche die Märtyrer in vollendeter Weise verwirklichen. Die theologische Entfaltung dieses biblischen Themas – stark geprägt von platonischen und stoischen Elementen – führt zu verschiedenen Systematisierungen. Ihnen gemeinsam ist, dass Streben zur Vollkommenheit von sich ergänzenden und nicht eindeutig abgrenzbaren Disziplinen („Wegen“) geprägt ist, in welchen sich Christinnen und Christen üben: In der Reinigung (Askese) sollen Tugenden, Selbstkontrolle und Festigung des Charakters erlangt werden. Die Erleuchtung (Mystik) soll durch Gebet und Meditation erlangt werden, die in Gottesschau bzw. Vereinigung mit Gott kulminiert und als reine Gnade erlebt wird. Die patristischen Lehren zur Askese und Mystik haben die folgenden Jahrhunderte massiv geprägt und lassen sich in der Geistesgeschichte bis heute verfolgen.
09.10.2019: Spiritualitätstraditionen/-praktiken MA / Dozent: Delgado, Mariano
Inhalte: Die Vorlesung setzt bei Bernhard von Clairvaux als Brücke zur „neuen Mystik“ an und erläutert die Gebets- und Spiritualitätstraditionen des Mittelalters, die von diesen Tendenzen geprägt waren: Ausdifferenzierung des Schemas Lectio divina, Oratio, Meditatio, Contemplatio; mystische Prägung der eigenen Ordenstradition (franziskanische Mystik, dominikanische Mystik etc.); Bemühung einiger Mystiklehrer (z.B. Eckhart, Tauler, Seuse mit der Theologia deutsch) um die Öffnung der spirituellen Traditionen für das Volk (Laien, Ordensfrauen); Richtungskämpfe und Vorgehen der Inquisition gegen Begarden und Beginen; Wachsen der spirituellen Sehnsucht des Laienvolkes in der devotio moderna; Trend zum inneren Beten am Ende des 15. Jh.s.
16.10.2019: Spiritualitätstraditionen/-praktiken in katholischen und reformatorischen Kontexten (Neuzeit ) / Dozent: Delgado, Mariano
Inhalte: Die Vorlesung setzt beim Trend zum inneren Beten um 1500 an und zeigt zunächst, wie dies bei Luther und den frühen katholischen Reformern (Recogido-Bewegung) prägend war. Danach geht es um Spanien als Schauplatz von spirituellen Richtungskämpfen im Schatten dieses Trends (dejados/recogidos). In einem dritten Schritt werden die Akzente der drei grossen katholischen Mystiker Ignatius von Loyola, Teresa von Avila und Johannes vom Kreuz vorgestellt. Danach geht es um die Wirkung dieser Tendenzen im 17. Jh. (Richtungskampf zwischen den Meditativen oder Aktiven und den Kontemplativen, der den Hintergrund der grossen Quietismuskrise bildet und zur grossen Mystikkrise in der katholischen Kirche Ende des 17. Jh.s. führt). Abschliessend wird die Neuentdeckung der Mystik im Protestantismus (Pietismus) dargestellt.
23.10.2019: Spiritualität und Gotteskonzept / Dozentin: Hoffmann, Veronika
Inhalte: Spirituelle Praktiken, mehr noch aber das Verständnis von Spiritualität haben auch mit dem jeweiligen religiösen Selbstverständnis zu tun. In christlicher Perspektive lässt sich insbesondere nach der Vorstellung von Gott und seinem Verhältnis zur Welt fragen. Wenn beispielsweise darum gestritten wird, ob bestimmte Gestalten von Spiritualität christlich seien oder nicht, geht es nicht selten um das sich in diesen Gestalten artikulierende Gottesbild. Zugleich scheint es Parallelen zwischen Veränderungen in christlichen Spiritualitätsdiskursen und neuen systematisch-theologischen Reflexionen auf den Gottesbegriff zu geben. Die Vorlesung geht solchen – tatsächlichen, möglichen oder auch nur scheinbaren – Zusammenhängen nach.
30.10.2019: Spiritualitätstraditionen/-praktiken Judentum / Dozent: Rutishauser, Christian
Inhalte: Das Wort „Spiritualität“ ist der jüdischen Tradition fremd. Auch das Wort „Mystik“, das aus dem christlichen Kontext stammt, wird mit dem Adjektiv „jüdisch“ versehen, um damit die Kabbala zu bezeichnen. Es gilt, hinter diesen Sprachverschiebungen die dem Judentum eigenen Geistvollzüge und Denkfiguren wahrzunehmen, die seine Frömmigkeitsgeschichte prägen, sei es im klassischen Rabbinismus, in der Kabbala oder im Chassidismus. Ihnen gemeinsam ist die Vergegenwärtigung der Tora durch verschiedene Formen des Midrasch (Exegese) und durch die metaphysische Vertiefung der Mitzwot (Gebote). Auch das Messianische durchwirkt die jüdische Frömmigkeit immer wieder. Die Vorlesung gibt einen Einblick in „jüdische Spiritualität“ und wählt dazu exemplarische Beispiele aus verschiedenen Epochen.
06.11.2019: Sufigruppen in der Schweiz – ein alternativer Weg des Islams? / Dozent: Schmid, Hansjörg
Inhalte: In öffentlichen Diskussionen in der Schweiz finden mystische Strömungen des Islams meist keine grössere Beachtung. Die Vorlesung zeigt anhand von Beispielen auf, in welcher Form Sufigruppen in der Schweiz aktiv sind. An welche Traditionen knüpfen sie an? In welchem Verhältnis stehen kontemplative und aktive Schwerpunkte? Wieso ist der Sufismus bei jungen Muslimen besonders beliebt? Können diese Gruppen als Ausdrucksform eines „Schweizer Islams“ angesehen werden?
13.11.2019: Der Mahayana-Buddhismus und die Kritik an leichtfüßiger Erkenntnis / Dozent: Zander, Helmut
Inhalte: Im Buddhismus trifft man auf ausgesprochen skeptische Erkenntnistheorien. Alles, was wir wahrnehmen, alles, was wir an Repräsentationen und symbolischen Formen konzipieren, steht dann unter dem Vorbehalt, ein bloßes Konstrukt unseres Geistes zu sein. Warum sind solche Positionen für Buddhisten attraktiv? Dies soll an Texten und Praktiken aus der Mahayana-Tradition erläutert werden. Was können Christen daraus lernen? Wo finden sich Anschlussstellen für den buddhistisch-christlichen Dialog?
20.11.2019: Reinkarnationsspiritualität: Sollen wir uns nicht lieber selbst erlösen? / Dozent: Zander, Helmut
Inhalte: „Esoterische“ Praktiken und Vorstellungen sind Teil einer „fluiden“ Religiosität, die inzwischen nicht nur die Gesellschaft, sondern auch die Kirchen durchdringt. Im Hintergrund stehen Vorstellungen einer spirituellen Autonomie des Menschen, die oft in Konzeptionen der Selbsterlösung münden. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Annahme einer Reinkarnation, der in Europa (je nach Land und Art der Umfrage) zwischen 10 % und 30 % der Menschen anhängen sollen. Warum ist die Vorstellung einer erneuten Geburt attraktiv? Wie konnte es dazu kommen, dass die Vorstellung von Gnade faktisch eliminiert wurde? Lässt sich die Vorstellung einer Reinkarnation in das christliche Lehrgebäude integrieren?
04.12.2019: Spiritualität aus der Liturgie. Herausforderungen der Gegenwart vor dem Hintergrund geschichtlicher Orientierungen / Dozent: Klöckener, Martin
Inhalte: Die Liturgie wird als Zentrum des Handelns der Kirche betrachtet. Deren verschiedene Aktivitäten bündeln sich und konvergieren gewissermassen im gottesdienstlichen Leben. Dabei kommt die spirituelle Dimension der Liturgie auf unterschiedliche Weise zum Tragen. Dieser Aspekt ist besonders zu Beginn des 20. Jahrhunderts von massgeblichen Vertretern der Liturgischen Bewegung neu ins Bewusstsein gehoben worden. Vor dem Hintergrund dieser geschichtlichen Orientierungen geht es zum einen um die Frage, inwiefern die Liturgie in der Gegenwart Quelle der Spiritualität ist oder potentiell sein kann. Dies ist einerseits im Blick auf die Praxis der längst nicht mehr täglichen Eucharistiefeier, der Tagzeitenliturgie als Feier der Gesamtgemeinde, der Wortgottesfeiern, die vielerorts gerade an Sonn- und Festtagen eine besondere Bedeutung als Ersatz für die Eucharistiefeier erhalten haben, zu erarbeiten. Wer feiert diese klassischen Formen der Liturgie? Inwiefern sind sie Quelle der Spiritualität? Andererseits ist ein Blick auf neue rituelle Ausdrucksformen zu werfen, die die Kirche auch für und mit Mitmenschen ohne intensivere Kirchenbindung oder für Nicht-Getaufte anbietet. Welche Bedeutung haben diese Feiern? Wie sind sie theologisch zu bewerten? Und vor allem: Was tragen sie bei zur Spiritualität der Gegenwart?
11.12.2019: Spiritualität, Religiosität und kirchliche Praxis / Dozent: Loiero, Salvatore
Inhalte: Was gängig als Revival von Religion bzw. Religiosität bezeichnet wird, zeigt sich in einer differenzsensiblen Sichtung nicht selten als „Revival von Spiritualität(en)“ (Zygmunt Bauman). Diese Differenzsensibilität fordert die Praxis der Kirche neu heraus. Vor allem dann, wenn sie versucht auf diese „Zeichen der Zeit“ aus einer (selbst)kritischen Zeitgenossenschaft heraus praxisbezogen zu antworten. Für diese Differenzsensibilität erweist sich eine kritische Verhältnisbestimmung von Erfahrung und Widerfahrung (E. Schillebeeckx) als unabdingbar, um Mystik und Praxis (J.B. Metz) in ihrem gegenseitig sich durchdringenden Spannungsverhältnis nicht gegenseitig aufzuheben, sondern in plurale Formen praktischer Spiritualität(en) zu überführen, die für die Christ_innen von heute Ausdruck gelebter Religiosität ist, weil sie „etwas erfahren haben“ (K. Rahner).
18.12.2019: Interdisziplinäre Sitzung mit Dozierenden der Ringvorlesung
Lernziele
Die Studierenden erwerben vertiefte Kenntnisse zur Bedeutung von Spiritualität in Geschichte und Gegenwart von Religionen, Kirchen und Gesellschaften. Sie sind fähig, Formen und Dimensionen von Spiritualität wahrzunehmen und theologisch zu reflektieren.
Dokumentation
Literatur wird in den einzelnen Vorlesungseinheiten bekanntgegeben.