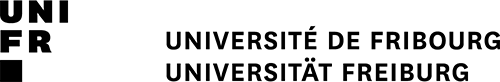Publikationsdatum 12.04.2021
Das Wort des Dekans, Mariano Delgado - FS 2021/II
Hoffnung auf die grosse Verwandlung
Liebe Freunde, liebe Freundinnen und liebe Mitglieder der Theologischen Fakultät!
Wer kennt nicht das erstmals 1865 erschienene Kinderbuch „Alice im Wunderland“ des britischen Schriftstellers Lewis Carroll? Darin ist vielfach von der „Verwandlung“ die Rede, und von Alice’ Schwierigkeiten damit. So sagte sie zu der Raupe: "‘Vielleicht haben Sie es noch nicht versucht, aber wenn Sie sich in eine Puppe verwandeln werden – das müssen Sie über kurz oder lang wie Sie wissen –, und dann in einen Schmetterling, das wird sich doch komisch anfühlen, nicht wahr?’ ‘Durchaus nicht’, sagte die Raupe. ‘Sie fühlen wahrscheinlich anders darin’, sagte Alice; ‘so viel weiss ich, dass es mir sehr komisch sein würde.’ ‘Dir!’ sagte die Raupe verächtlich. ‘Wer bist du denn?’"
Auch ein solcher literarischer Dialog kann Anlass für das Nachdenken über die Auferstehung sein, die grösste aller Verwandlungen und die Bestimmung des Menschen. Je mehr wir darüber nachsinnen und zu begreifen versuchen, desto mehr müssen wir die Waffen des Verstandes strecken und zugeben, dass unsere Hoffnung grösser ist als unser Wissen. Wir merken, dass wir mehr zu begreifen versuchen, als wir vermögen: wer sind wir, um es fassen zu wollen? Für die Sehnsucht nach Mehr als diese unvollkommene Welt bleibt uns dann nur die poetische Bildersprache mit Metaphern, die an das uns Bekannte und Vertraute kontrafaktisch verweisen: „Leben in Fülle“ (Joh 10,10); „einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen die Gerechtigkeit wohnt“ (2 Petr 3,13); ein Wohnen bei Gott, der alle Tränen von unseren Augen abwischen wird: „Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen“ (Offb 21,4).
Von Anfang an tragen wir eine göttliche Berufung in uns. Gott hat unser "Innerstes geschaffen" und "gewoben" im Schoss unserer Mutter, wie der Psalm 139 im poetischsten biblischen Ausdruck der universalen Gotteskindschaft sagt.
Von Anfang an tragen wir eine göttliche Berufung in uns. Gott hat unser "Innerstes geschaffen" und "gewoben" im Schoss unserer Mutter, wie der Psalm 139 im poetischsten biblischen Ausdruck der universalen Gotteskindschaft sagt. Wenn wir jedoch den Gang der Geschichte mit Krankheit und Leid, Ungerechtigkeit und Gewalt, Schuld und Tod betrachten, sind wir versucht zu fragen: "Wo ist dieser Gott, der uns so sehr lieben soll?" Denn das Böse in der Welt und in uns und auch der Tod lassen sich nicht einfach als Folge der menschlichen Freiheit erklären. Die alten Katechismus-Antworten haben ihre naive Plausibilität verloren. Unter dem Eindruck der Schrecken der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft hat Walter Benjamin sogar den kühnen Gedanken gewagt, dass auch die Toten vor dem Feind, wenn er siegt, nicht sicher sein werden: „Und dieser Feind hat zu siegen nicht aufgehört.“ Dies ist für viele die nüchterne Geschichtserfahrung auch 2000 Jahre nach der Auferstehung Jesu, von der der Apostel Paulus sagt, dass damit der Tod seinen Sieg und seinen Stachel verloren hat (1 Kor 15,56). Die Geschichte ist weiter gegangen, und auch die Geschichte der Christen ist von Habgier und Gewalt gegen den Nächsten geprägt, von Mammon und Moloch.
In der Theologiegeschichte war der universalistische Gedanke der Allaussöhnung oder Allerlösung nach Kol 1,20, wonach Gott durch Christus alles zu sich führen wird, immer wieder präsent, oftmals jedoch von einer ekklesiozentrischen Theologie verdeckt, die die Rolle der Kirche als Gnadenanstalt überbetonte. Das Zweite Vatikanische Konzil war bemüht, die Augen erneut auf den Heilsuniversalismus deutlich zu richten, wie dies die wirklich grossen Theologen und Mystiker immer taten. So etwa wenn in „Gaudium et spes“ (Nr. 22) von der in der Auferstehung Jesu begründeten Hoffnung der Christen die Rede ist, die uns hilft, „gegen das Böse durch viele Anfechtungen hindurch anzukämpfen und auch den Tod zu ertragen“. Von dieser Hoffnung wird dann gesagt, dass sie nicht nur für die Christgläubigen gilt, „sondern für alle Menschen guten Willens, in deren Herzen die Gnade unsichtbar wirkt. Da nämlich Christus für alle gestorben ist und da es in Wahrheit nur eine letzte Berufung des Menschen gibt, die göttliche, müssen wir festhalten, dass der Heilige Geist allen die Möglichkeit anbietet, diesem österlichen Geheimnis in einer Gott bekannten Weise verbunden zu sein.“
Wer sind wir, um in das Geheimnis zwischen Gott und einem jeden Menschen hineinblicken oder dem Heilsuniversalismus Gottes Grenzen setzen zu wollen, der uns bereits sah und liebte, als wir noch „gestaltlos“ (Ps 139,16) waren?
„In einer Gott bekannten Weise“ – wer sind wir, um in das Geheimnis zwischen Gott und einem jeden Menschen hineinblicken oder dem Heilsuniversalismus des menschenfreundlichen Gottes Grenzen setzen zu wollen, der uns bereits sah und liebte , als wir noch „gestaltlos“ (Ps 139, 16) waren? Blicken wir lieber auf das Beispiel derjenigen Christen und Christinnen, die hier die „Verwandlung“ durch das reinigende Feuer Christi erlebt haben, eine Form der Auferstehung mitten im Leben.
Einer davon war der Apostel Paulus, der immer wieder ansetzte, uns diese Verwandlung mitzuteilen – in paradoxen Aussagen, die etwas von unserer aller Berufung ahnen lassen: „Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir“ (Gal 2,20). Oder: „Wer sich an den Herrn bindet, ist ein Geist mit ihm“ (1 Kor 6,17). Oder: „Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so strebt nach dem, was oben ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt! … Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott“ (Kol 3,1-3).
In einer anderen und zugleich ähnlichen Sprache hat Teresa von Ávila ihre eigene Verwandlungserfahrung ausgedrückt (jede Erfahrung der Christusförmigkeit ist einzigartig!). Dreihundert Jahre vor „Alice im Wunderland“ staunte sie auch über die Verwandlung der Seidenraupen: „Und dann spinnen sie aus sich selbst mit ihren Mäulchen die Seide und machen sich ganz enge winzige Hüllen, in die sie sich einschliessen. Die Raupe aber, gross und hässlich, verendet, während aus eben dieser Hülle ein winziger, sehr anmutiger, weisser Schmetterling ausschlüpft.“ Für Teresa ist die Seidenraupe der Mensch, der sich seiner göttlichen Berufung bewusst geworden ist und durch ein tugendhaftes Leben in seinem Inneren eine angenehme Wohnung für Gott (Joh 4,23) einrichtet, für jenen Gott, der uns bereits im Mutterschoss gewoben und sich uns in Christus gezeigt hat: „Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen“ (Joh 14,9).
Menschen wie Teresa erleben bereits hier die Verwandlung in einen neuen Menschen; sie werden wie die Raupe zu einem Falter, der frei fliegt, freimütig und gelassen. Sie erleben die Auferstehung mitten im Leben und wissen sich bei Gott durch alle Widrigkeiten hindurch geborgen, komme, was da kommen mag: „Denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir“ (Apg 17,28). Sie wissen, dass sie „über kurz oder lang“ sterben werden, aber der Tod hat dann für sie seinen Stachel wirklich verloren. Der Tod, den Franziskus seinen Bruder nannte, bedeutet dann, die letzte Schwelle zur Begegnung mit jenem Gott zu überschreiten, der Liebe ist (1 Joh 4,8) und der auch über den Tod hinaus nicht aufhören wird, um uns zu werben, bis wir durch die Reinigung hindurch, die jeder nötig haben wird, bei ihm das verheissene „Leben in Fülle“ (Joh 10,10) geniessen – auch wenn es sich hienieden "doch komisch anfühlen" mag.
Diese Hoffnung auf die grosse Verwandlung nach der letzten Schwelle und die Erfahrung davon mitten im Leben, die die brennende Sehnsucht steigert, wünsche ich uns allen zu Ostern 2021!
Mariano Delgado, Dekan